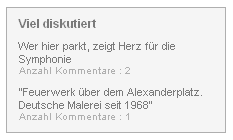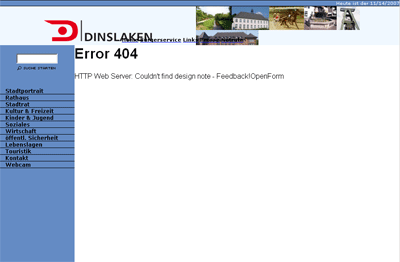Willkommen zurück an der Coffee-And-TV-Journalistenschule!
Nachdem wir beim letzten Mal gelernt haben, wie man eine Gerichtsreportage verfasst, wollen wir uns heute dem Bereich des Musikjournalismus zuwenden. Besonders beliebt auf diesem Gebiet sind seit längerem Reportagen, die einen Künstler oder eine ganze Band in einem heimatlichen Umfeld zeigen. Dafür brauchen wir zunächst einmal eine Band, was nicht ganz so schwer ist: Wir nehmen einfach unsere Coffee-And-TV-Hauskapelle.
Als erstes brauchen wir jetzt (wie bei jedem Artikel) einen griffigen Einstieg. Oder aber einen, der so wirr ist, dass man schon aus Neugierde, wie sich der Autor wohl daraus befreien will, weiterliest:
Entweder hast du als Teenager die Gelegenheit, vor dem Venue auf deinen Lieblingsact zu warten und dir Autogramme geben zu lassen – oder du hast sie nicht. Entweder du kennst die Bands nur aus TV, Radio und Internet – oder du triffst sie im Plattenladen. Die Kilians kommen aus Dinslaken und trafen bisher niemanden. Sie sind eine aufstrebende Rockband. Die Frage ist: Trotzdem oder gerade deswegen?
Was ist mit denen, die nie vor einem “Venue” standen und auf ihren “Lieblingsact” warteten? Wer hätte in welchem Plattenladen jemanden treffen sollen? Wieso ist man eine aufstrebende Rockband, obwohl oder weil man niemanden in einem Plattenladen getroffen hat? Der Leser ist sofort gefangen von diesen Sätzen und könnte sie immer wieder lesen, ohne dass ihm die Deutungsmöglichkeiten ausgingen.
Im zweiten Absatz sollten wir dem Leser, der die zu porträtierende Band noch nicht kennt, kurz erklären, von wem wir sprechen. Zum Beispiel so:
The Kilians sind fünf Jungs und kommen aus dieser Stadt, und sie sind mittlerweile im Blickfeld vieler, die sich für Rockmusik interessieren. In Dinslaken sind sie allein dadurch schon Stars.
So weiß jeder, dass man in Dinslaken, pardon: Dinslaken alleine dadurch zum Star wird, dass man im Blickfeld vieler, die sich für Rockmusik interessieren, ist. Soziologen sprechen sicher von second hand popularity.
Wenn wir merken, dass wir eigentlich viel lieber über die Stadt schreiben möchten als über die Band, können wir jetzt immer noch die Kurve kratzen und Vergleichsgrößen heranziehen:
Um das zu verstehen, muss man sich klarmachen, wie wenig Orte wie Dinslaken von der Distinktion geprägt sind, die in Hamburg oder Berlin allgegenwärtig ist.
Eine klare Positionsbestimmung: Hamburger und Berliner werden sagen: “Klar, Distinktion, Alter!”, alle Anderen werden erfurchtsvoll nicken und es nicht wagen, nach den in diesen Metropolen vorherrschenden Distinktionen zu fragen.
Jetzt haben wir dem Leser unser Bild von Dins… Dinslaken schon so genau gezeichnet, dass wir uns ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und Fakten gekonnt ignorieren können:
Hier schielt kaum jemand auf Düsseldorf oder Köln, die nächsten größeren Städte und die Codes der Indie-Schickeria bedeuten hier gar nichts.
Keiner unserer Leser wird auch nur ahnen, dass wir schon bei unserer Ankunft halbe Armeen von röhrenbehosten Ringelpulliträgern mit Emofrisuren gesehen haben, die gerade auf dem Weg zu einem Rockkonzert in Köln waren. Solche Informationen würden ja auch nur das Bild zerstören, das wir mühevoll vor den geistigen Augen unserer Rezipienten aufzubauen versuchen. Die Möglichkeit, dass die derart übergangenen Indie-Kiddies der Stadt per Leserbrief auf ihre Unterschlagung hinweisen könnten, lösen wir mit einem kleinen Logikwölkchen: Es gibt sie ja gar nicht, haben wir gerade noch geschrieben.
Als die Kids die beiden Bandmitglieder, begleitet von der Presse, auf sich zukommen sehen, fahren sie nervös aus ihren lässigen Posen auf.
Geschickt gerettet: Die drei Leser, die sich jetzt wundern könnten, wo denn plötzlich bemüht lässige “Kids” (als Musikjournalist sollte man das Wörterbuch der Jugendsprache stets bei sich führen, und wenn es die Ausgabe von 1991 ist) herkommen, müssen jetzt alle Hirnmasse auf die Vorstellung verwenden, wir selbst liefen wie in einem Hollywoodfilm der dreißiger Jahre mit einem Pappkärtchen mit der Aufschrift “Presse” im Hutband durch die Gegend.
Hatten wir überhaupt schon erwähnt, wo diese langweilige Kleinstadt, die kein Schwein kennen muss, liegt? Nein? Dann ist jetzt die Gelegenheit, auf das Ruhrgebiet hinzuweisen und gleich eine weitere LKW-Ladung Klischees über Text, Lesern und Landschaft auszukippen:
Ganz ruhrgebietstypisch. Natürlich ist die örtliche Zeche mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Natürlich sind alle Arbeiter entlassen – bis auf ein paar, die mit dem Abbau der Maschinen beschäftigt sind. Von Momenten an solchen Orten weiß im Ruhrgebiet jeder etwas zu erzählen. Auch die Kilians. Zechengeschichten sind in der Regel Nachtgeschichten, sie handeln von Alkohol und davon, irgendwo draufzuklettern und in den Sternenhimmel zu schauen.
Es ist egal, wenn dem Absatz nichts vorausging, worauf sich das “ruhrgebietstypisch” beziehen könnte, denn wir nähern uns dem Höhepunkt:
Alles, was von solchen erhöhten Standorten zu sehen ist, wenn man etwas tiefer blickt, ist: Kohle, Stahl und graue Wolken. All das impliziert in dieser Gegend zwangsläufig immer auch eines: das Scheitern. Für eine Rockband sind das lehrreiche Erfahrungen. Bewusst oder auch nicht, die Kilians haben ihre Schlüsse daraus gezogen.
Jaaaaa, diese vier Sätze sind von unendlicher Weisheit und Tiefe. Zunächst einmal wissen die Leser anschließend, dass die (natürlich immer “grauen”) Wolken im Ruhrgebiet niedriger hängen als irgendwelche Sachen (Abraumhalden, Fördertürme, Musikjournalistenegos), auf die man “draufklettern” kann, hoch sind. Dann lernen sie, dass Kohle, Stahl und eben jene grauen Wolken nichts anderes sind als Metaphern für “das Scheitern” und nicht etwa industrielle Rohstoffe (die ersten beiden) und Wetterphänomene (letzteres).
Aber weiter im Text: Scheitern, Kohle, Stahl und Wolken – all das sind “lehrreiche Erfahrungen”, aus denen die jetzt doch mal wieder namentlich zu erwähnende Band ihre Schlüsse gezogen hat. Spätestens hier werden sich selbst Distinktionserfahrene Leser aus Hamburg und Berlin, Düsseldorf oder Köln von Minderwertigkeitskomplexen geplagt auf dem Boden wälzen und rufen: “Großer Musikjournalist, ich bin unwürdig, Deinen Ausführungen zu folgen, aber sprich weiter und vergiss auch die Fremdwörter nicht, die Du Dir im ‘Adorno für Anfänger’-Seminar auf der Rückseite Deines Collegeblocks notiert hast!”
Damit haben wir sie im Sack und können noch ein paar Zitate der Bandmitglieder einstreuen. Die interessieren zwar weder uns, noch die Leser, aber eine Bandreportage ohne Band wirkt halt immer etwas schwach. Dafür können wir sie mit gehässigen, kleinen Partikeln anmoderieren, die transportieren, dass immer nur der doofe Sänger geredet hat:
Wiederum Simon: “Wir glauben, dass die Leute hier auf so was warten. Sie wollen, dass hier nicht nur lokale Acts spielen, sondern auch welche, die sie aus dem Radio kennen. Die Bühne soll auf der Wiese stehen, und das Feuerwehrhaus dort hinten wird der Backstagebereich.”
Jetzt fehlt nur noch ein Schlusssatz, der das bisher Gelernte zusammenfasst:
So sieht DIY aus, wenn er nicht aus Washington oder Olympia, sondern aus Dinslaken kommt.
Es wird schon niemand fragen, warum wir von einem Bundesstaat oder einer Stadt reden, von der außer uns noch 23 Personen wissen, dass sie als Neben-Hochburg des amerikanischen Indierocks gilt. Wenn sich überhaupt noch jemand etwas fragt, dann, wie wohl DIY aussehen könnte, bei dem man nicht alles selber macht.
Wenn wir diese einfachen Regeln befolgen, werden wir bald schon alle fantastische Bandporträts schreiben können, die das Zentralorgan des deutschen Qualitätsmusikjournalismus, der/die/das Intro sicher gerne abdruckt.


 Die eigentlich sehr sinnvolle Geo-Tagging-Funktion, mit der bei jedem Artikel der “Ort des Geschehens” angezeigt werden soll, wird leider kaum genutzt – dafür sind nämlich die User zuständig und deren Zahl liegt nach vier Wochen bei der einigermaßen deprimierenden Zahl von
Die eigentlich sehr sinnvolle Geo-Tagging-Funktion, mit der bei jedem Artikel der “Ort des Geschehens” angezeigt werden soll, wird leider kaum genutzt – dafür sind nämlich die User zuständig und deren Zahl liegt nach vier Wochen bei der einigermaßen deprimierenden Zahl von