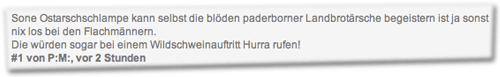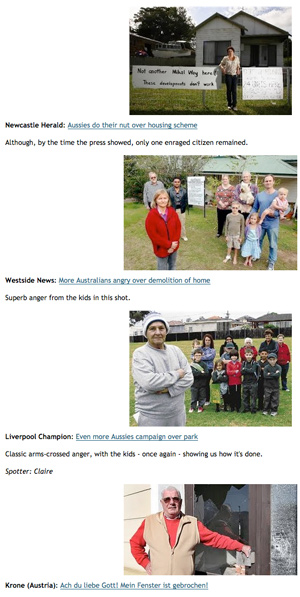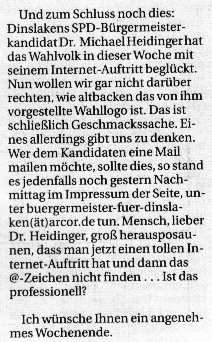Die Veranstalter des Bochumer Volksfests “Bochum Total” haben heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, ab dem nächsten Jahr nicht mehr mit der örtlichen Brauerei Moritz Fiege (indirekt bekannt aus unseren “Cinema And Beer”-Podcasts) zusammenzuarbeiten, sondern die Getränke für ihre Großveranstaltung von der Duisburger König-Brauerei zu beziehen. Das war theoretisch schon bekannt, seit vor einigen Wochen ein (inzwischen wieder gelöschtes) Plakat mit “Köpi”-Schriftzug auf der Facebook-Seite von “Bochum Total” aufgetaucht war, aber vielleicht darf man von Lokaljournalisten auch nicht zu viel erwarten.
Jetzt ist die Nachricht jedenfalls offiziell in der Welt und es bahnt sich das an, was sie im Internet einen “Shitstorm” nennen, weswegen ich die Gelegenheit nicht ungenützt verstreichen lassen möchte, für diesen Zweck den/die/das Hashtag “Saufschrei” vorzuschlagen.
Die Empörung ist nachvollziehbar und zielt zugleich weitgehend ins Leere: Die Annahme, ein Volksfest dieser Größenordnung hätte irgendwas mit dem Volk zu tun, wäre naiv. Natürlich geht es bei “Bochum Total”, dem Münchener “Oktoberfest”, dem Hamburger “Hafengeburtstag” und womöglich selbst beim Karneval heutzutage vor allem ums Geld. Zwar würden sie beim Oktoberfest vermutlich eher nicht auf die Idee kommen, das Bier aus dem Umland zu beziehen, aber so viel Tradition hat “Bochum Total” dann auch noch nicht anhäufen können. Selbst wenn alle Lokalpatrioten, die die ausrichtende Agentur “Cooltour” gerade auf Facebook beschimpfen, im kommenden Jahr tatsächlich zuhause blieben, dürfte das bei den vielen hunderttausend Besuchern, die sich alljährlich durch die Bochumer Innenstadt schieben, kaum ins Gewicht fallen. Vielleicht kommen sogar wieder ein paar mehr, um sich das banale Musikprogramm, das oft wie direkt von Plattenfirmen und Medienpartnern zusammengestellt aussieht, die Bratwurstbuden und – dann neuen – Bierstände anzuschauen.
Die Veranstalter beeilten sich, sogleich noch ein Statement der mutmaßlich geschassten Fiege-Brauerei zu veröffentlichen, in dem der Inhaber Hugo Fiege den – für meinen Geschmack etwas zu sehr an gefeuerte Fußballtrainer erinnernden – Satz sagt, es sei “es an der Zeit, neue Perspektiven zu suchen und zu finden”. Das klingt ehrlich gesagt nicht sehr überzeugend, kann aber auch völlig ernst gemeint sein.
Partnerschaften auf diesem Gebiet gehen oft genug mit dem Adjektiv “strategisch” einher. Das darf man nicht mit Tradition verwechseln: Auch beim Haldern Pop Festival wird seit 2012 König Pilsener ausgeschenkt und damit die mehr als 15 Jahre währende “niederrheinische Freundschaft” zwischen dem Festival und der Diebels-Brauerei beendet. Diebels kommt theoretisch aus Issum, gehört aber zum global player Anheuser-Busch InBev und wer weiß, was dessen Controller von “niederrheinischer Freundschaft” verstehen.
Auch die Veranstalter des Haldern Pop zeigten sich ein Stück weit flexibel und erklärten:
Bier ist Heimat. Und so musste es ‘das König der Biere’ aus dem nahen Duisburg-Beek sein.
Eine Kernzielgruppe von “Bochum Total” sind – überspitzt gesagt – Jugendliche, die mit etwas Glück schon legal Bier trinken dürfen und dies vermutlich eher nicht an Bierständen tun — die sind eher für eine andere Kernzielgruppe: die Familien und Vereine, für die die überfüllte Innenstadt ein beliebtes Ausflugsziel ist. Wenn beide jetzt bei Facebook ihrem Ärger Luft machen, zeigen sie damit ein Verständnis für Traditionen, das es andernorts schon nicht mehr gibt. So kann man das sehen.
Man könnte aber auch sagen: Die Leute sind so unflexibel wie jene Leserbriefschreiber, die mit Abo-Kündigung drohen, wenn ihre Tageszeitung nach zehn Jahren mal wieder ein neues Layout bekommen hat. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es dann, aber er gewöhnt sich auch erstaunlich schnell um.
Fiege schmeckt mir trotzdem bedeutend besser als “Köpi”.