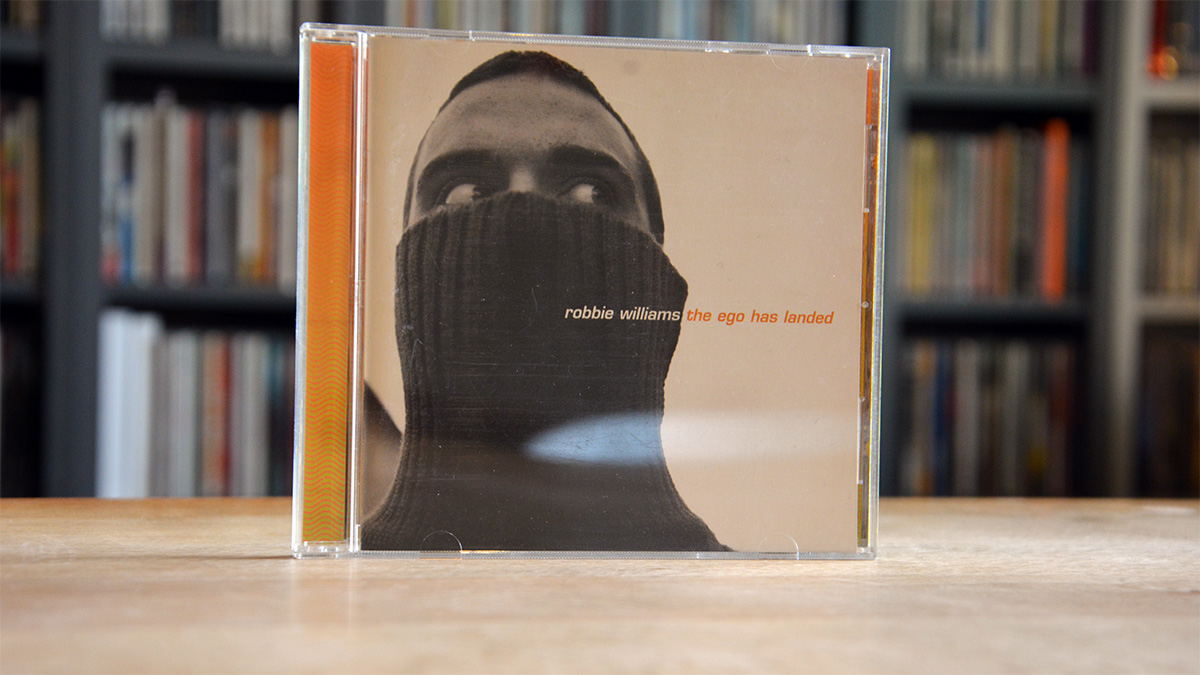In den letzten Wochen ging ein kurzes Video viral, das die beiden Medienpersönlichkeiten Markus Lanz (* 1969) und Richard David Precht (* 1964) auf dem „Kongress Zukunft Handwerk“ zeigt — ansonsten aber ganz in ihrem Element, der gegenseitigen Zustimmung:

Lanz: „[…] so ‘ne gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so ‘ne Hafermilch-Gesellschaft, so ‘ne Guavendicksaft-Truppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist.“
[Schnitt.]
Precht: „Also, ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen: In der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, Du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst Du: Nee, nee, das war das Falsche; schmeißt die Flinte wieder ins Korn.“
Dieser Ausschnitt hat zu einer ganzen Reihe öffentlicher Äußerungen geführt, hier ist die nächste:
Ich habe natürlich nicht den ganzen Auftritt der beiden gesehen, denn wenn ich zwei Männer sehen will, die einander, vor allem aber sich selbst, geil finden, gucke ich mir weichgezeichnete Schwulen-Pornos an.
Als erstes muss man Lanz vermutlich dankbar sein, dass er nicht von „Algarven-Dicksaft“ gesprochen hat.
Dann muss man anerkennen, dass er seinen Barth ziemlich genau studiert hat. „Hafermilch“ ist in gewissen Kreisen schließlich das, was „Schuhgeschäft“ in anderen ist: eine Abkürzung zum Gelächter, die mechanische Auslösung eines Reflexes anstelle einer ausgearbeiteten Pointe. Der Dumme August tritt dem Weißclown in den Hintern und Grundschulkinder quieken entzückt auf — wobei wir noch klären müssen, wer in diesem Ausschnitt eigentlich welche Rolle einnimmt (ich persönlich würde sagen: Es gibt außerhalb von Tierquälerei im Circus nichts Schlimmeres als den Weißclown, von daher sind einfach beide einer).
Ich möchte eigentlich nicht den gleichen Fehler begehen wie Lanz, Precht und die Leute, die ihnen zustimmen, und gleich ad hominem gehen. Nur: So viel anderes als ihre Persönlichkeiten (oder zumindest ihre öffentlichen personae) haben die beiden ja gar nicht zu bieten. Beide wirken wie die Personifizierungen des Aphorismus (und falschen Karl-Kraus-Zitats), wonach bei niedrig stehender Sonne der Kultur auch Zwerge lange Schatten würfen. Sie sind – ob aus Zufall, Kalkül, Patriarchat oder schlichtem Versehen – im Laufe der Zeit zu dem geworden, was sich sprichwörtliche Durchschnittsdeutsche unter einem Journalisten und einem Philosophen vorstellen. Schon allein das ist ungefähr so absurd, als ob diese Prototypen in den 1990er Jahren mit Hans Meiser und Helmut Markwort besetzt worden wären.
Wenn man sich den Ausschnitt ganz genau anguckt, wird man den Eindruck nicht los, dass der Sit-Down-Comedian Lanz die Begriffe „Hafermilch-Gesellschaft“ und „Guavendicksaft-Truppe“ von langer Hand vorbereitet hat (oder vorbereiten hat lassen) und das stolze Grinsen unterdrücken muss, als sie beim Publikum den erhofften Erfolg erzielen. Er ist da ganz wie in seiner Fernsehsendung: wahnsinnig gut vorbereitet und deshalb so natürlich wie ein Versicherungsmakler kurz nach Beginn der Ausbildung. Es ist mir ein Rätsel, wieso Annalena Baerbock ständig vorgeworfen wird, wie eine „Schülersprecherin“ aufzutreten, Markus Lanz aber immer so eilfertig rumamthoren darf, ohne dass seine Gesprächspartner*innen ihn einfach anschreien (bzw. natürlich kein Rätsel, sondern ein Patriarchat).
„Hafermilch“ ist dabei das, was „Sojamilch“ vor zwölf Jahren war und davor „Latte Macchiato“: ein angeblich suspektes Getränk, das von Menschen getrunken wird, die man irgendwie ablehnt.
Schon diese Milch-Obsession schreit ja eigentlich direkt nach einer Freudianischen Einordnung — gerade bei einem Mann mit so einer Kondensmilch-Mentalität wie Lanz. Da will man direkt kontern: „Echte Männer sind für mich nur die, die von einer Wölfin gesäugt und aufgezogen wurden!“ Oder: „Wenn Du morgens um fünf aufstehst, um oben auf der Alm die Kühe zu melken, können wir über meinen Hafermilch-Konsum sprechen, aber ansonsten sei einfach still!“ Unlustiger kann’s eigentlich nur noch werden, wenn als nächstes jemand sagt: „Bielefeld gibt’s ja gar nicht!“
Humortheoretisch steht die Hafermilch dabei in der Tradition des Dinkel-Bratlings, mit dem Komiker*innen in den 1980er und 90er Jahren reüssieren konnten. Man könnte jetzt erwidern, dass vegetarische oder vegane Ersatzprodukte im Laufe der Jahrzehnte eine Entwicklung durchgemacht haben, die man auch dem deutschen Humor gönnen würde, aber da würde man schon wieder den grundsätzlichen, kapitalen Fehler begehen und sich in ein argumentatives Gespräch stürzen, wo von der Gegenseite nun wirklich keines gewünscht ist.
Lanz hat aber nicht nur seinen Barth studiert, sondern auch seinen Schmidt: Der einstige deutsche Groß-Humorist Harald Schmidt, dessen Lebenswerk man auch noch mal neu betrachten müsste, seit man weiß, dass es relativ unmittelbar zu Jan Böhmermann geführt hat, war 2019 in einem ORF-Interview auffällig geworden, in dem er moderne Väter als „Familientrottel“ bezeichnete (damals sehr schön dokumentiert und gekontert von Martin Benninghoff im F.A.Z.-Familienblog). Wenn Schmidt von „Daddy Weichei“ spricht und Lanz mit hörbarer Distanzierung von „Work-Life-Balance“, wüsste man gerne, was deren Kinder dazu sagen — und hat den Verdacht, dass es interessanter sein könnte als das, was ihre Väter seit Jahren so von sich geben.
Auch eine Umfrage in Prechts Familie wirkt verlockend: Vielleicht hätten Eltern und Großeltern „die Sinnfrage“ ja doch ganz gerne mal gestellt? Ich hab sicherheitshalber mal in der Wikipedia nachgeguckt, in was für Verhältnissen der Mann aufgewachsen ist:
Sein Vater, Hans-Jürgen Precht, war Industriedesigner bei dem Solinger Unternehmen Krups; seine Mutter engagierte sich im Kinderhilfswerk Terre des hommes. Richard David Precht hat vier Geschwister; zwei davon sind vietnamesische Adoptivkinder, die seine Eltern 1969 und 1972 als Zeichen des Protests gegen den Vietnamkrieg aufgenommen haben.
Okay, das hätte ich nach der Anmoderation nicht erwartet. (Bonustrack des Wikipedia-Eintrags: Die Antwort auf die Frage, wie man sich eigentlich das Adjektiv „selbstgefällig“ bildlich vorzustellen habe.) Irritierender ist aber noch, dass Precht, der ja gerne als „Philosoph“ wahrgenommen werden will, positiv hervorhebt, dass niemand „die Sinnfrage“ gestellt habe. (Auch das kann natürlich wieder Sinn ergeben: Wenn in seiner Familie wirklich nicht viel gedacht worden wäre, hätte er mit dem bisschen, was er so an Selbstgedachtem präsentiert, natürlich ordentlich auftrumpfen können.)
Eigentlich sollte man Mitleid haben mit Menschen, die so denken. Die gesellschaftlichen Fortschritt nicht als solchen begreifen, sondern als Degeneration. Die eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt haben, gegenüber der „Leistungsgesellschaft“ und gegenüber ihren Vorfahren, die sich oft genug derart abgeracktert haben, dass am Ende nicht nur keine balance übrig war, sondern mitunter auch gar kein life mehr. Wer so denkt, befindet sich bereits weit unten auf einer abschüssigen Ebene, die mit Schmierseife eingerieben ist und hinführt zum Satz: „Manchmal haben mir meine Eltern auch eine verpasst, aber das hat mir auch nicht geschadet.“
Von meinem Urgroßvater ist überliefert, dass er als Kind bei Tisch nur sprechen durfte, wenn er angesprochen wurde, und Vater und Mutter zu Siezen hatte. Ihre eigenen Kinder erzog diese Generation dann auf Grundlage des nationalsozialistischen Erziehungsratgebers „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, deren größte Sorge es war, dass das Kind „verweichlicht“ — ein Buch, das auch in der Nachkriegszeit noch als Klassiker der Erziehungsliteratur galt, ehe es vom nächsten Bestseller abgelöst wurde, der wieder propagierte, dass man Kinder am Besten alleine lässt, wenn sie Nähe brauchen. Naheliegend, dass man, wenn man so aufgewachsen ist, „gefühlig“ für ein Schimpfwort hält.
Es ist eine Sache, wenn man sich in der Vergangenheit geirrt hat: Als die ersten Zigaretten aufkamen, konnte man allenfalls ahnen, wie schädlich Rauchen sein würde (damals mutmaßlich auch nicht schädlicher als die normale Atemluft einer Industriestadt); Atomstrom galt mal als Versprechen einer „sauberen Zukunft“ und Heroin war mal für kurze Zeit das Wundermedikament der Firma Bayer. Aber eine Idee, die sich im Nachhinein als schlecht herausgestellt hat, noch zu feiern, dafür bedarf es schon einiger Energie, die man besser anderweitig investiert. (Oder man wählt am Ende doch Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden.)
Es sind schöne Erwiderungen auf Lanz und Precht geschrieben worden, zum Beispiel von Birgitta Stauber-Klein (Ein Doppelname! Feiertag für alle Hobby-Komiker!) in der „WAZ“ und von Christian Spiller im Sportteil von „Zeit Online“. Aurel Merz hat ein schönes, kurzes Video auf einem Junge-Leute-Portal namens TikTok gepostet. Die Begriffe „Boomer“ (Lanz ist streng genommen Generation X, aber ich sehe bei ihm auch keine Verbindung zu Ethan Hawke) und „deutsch“ tauchen immer wieder auf, aber auch „Generationenkonflikt“.
Und tatsächlich gibt es ja genug ältere Herren, die es als Aufmerksamkeitsgarantie (der Begriff „Alleinstellungsmerkmal“ verbietet sich komplett) erkannt haben, onkelhaft über jüngere Menschen und deren Themen sprechen. Sie gefährden dabei offenbar gerne den eigentlich positiven Ruf, den sie bei den jüngeren Generationen hatten, um noch eine vielleicht letzte Runde Schulterklopfen bei ihren Altersgenossen zu ernten. (Ich verzichte in diesem Absatz auf gendergerechte Sprache — nicht, um die Nerven der Angesprochenen zu schonen, sondern weil es eigentlich fast immer Männer sind. Aus Gründen der Ausgewogenheit möchte ich trotzdem sagen: Alice Schwarzer, Gloria von Thurn und Taxis.) Man kann nun milliardenfach daran erinnern, dass Satire sich ja „eigentlich“ immer gegen „die da oben“ richte, aber für Harald Schmidt, Dieter Nuhr (und im erweiterten Sinne auch: Thomas Gottschalk, Jürgen von der Lippe und am Ende alle Leute, die unter einem Artikel bei Welt.de kommentieren) sieht es so aus, als sei das, was sie irgendwie falsch, lächerlich oder bedrohlich finden, gesamtgesellschaftlich dominant.
Wenn man sich durch bestimmte Gegenden deutscher Großstädte bewegt, wird man dort halt auf „Mitt- bis Enddreißiger mit Struwwelpudelmütze“ (Schmidt; ich fühle mich ertappt, kann damit aber gut umgehen) oder eben „nahezu alle jungen Menschen“ (Precht) treffen, die dort vor allem deshalb Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil es ihnen finanziell möglich ist und sie die oft zu erwartenden Widerstände von Seiten der Arbeitgeber auszuhalten bereit sind. Aber schon dieser Eindruck ist ein Zerrbild: 2022 haben Frauen durchschnittlich 14,6 Monate Elternzeit beantragt, Männer nur 3,6. Schon ein paar Straßen weiter kann es ganz anders aussehen. (Wobei ich da auch vor allzu vereinfachenden Gedanken warnen möchte: Vielleicht ist es in einem eher linken, akademischen Milieu weiter verbreitet, auf die eigenen Bedürfnisse und – vor allem – die seiner Kinder zu achten, aber ich erlebe es regelmäßig im Fußballverein des Kindes, dass andere Eltern, die man der „Arbeiterklasse“ zurechnen würde, ebenfalls sehr sensibel auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen und die Leistung auf dem Platz nicht im Vordergrund steht. Mario Basler würde es hassen.)
Aber klar: Wenn man in ein urbanes Café geht und da Eltern sitzen, die ihre Kinder nicht durchgehend zurechtweisen, und man dazu vielleicht noch jede Menge Witze zu anti-autoritärer Erziehung (schlag den Unterschied nach, Jürgen!) im Stehsatz hat, sieht man mit jedem Hafermilch-Kaffee den Untergang der Welt – wenn nicht gar den der deutschen Wirtschaft – auf sich zukommen. So, wie die Leute, die mit der Straßenbahn zum Jobcenter fahren, um dort entwürdigende Fragen über sich ergehen lassen zu müssen, auch irgendwann denken, dass das ganze Land voller „Ausländer“ ist, weil sie in ihrem Alltag eben vor allem Menschen sehen, die „anders“ ausschauen, und sehr wenige Rechtsanwälte, die mehrere Mietshäuser haben, BMW fahren und FDP wählen.
Lanz’ Vortrag in dem Ausschnitt erinnert nur an eine unterdurchschnittliche Büttenrede, Prechts verallgemeinerndes „Wunschkonzert“-Geblubber macht mich wirklich wütend. Dafür habe ich zu viele Freund*innen immense Herausforderungen und Tiefschläge überwinden sehen, um mir diese Pauschal-Beleidigungen eines Millionärs anzuhören, der in jungen Jahren sicherlich oft genug gefragt wurde, ob er eigentlich studiere, um dann Taxi zu fahren. Fehlt wirklich nur noch, dass auch er von „Verweichlichlung“ spricht!
Die These, dass „früher“ alles besser gewesen sei, vor allem der Journalismus, wurde nahezu zeitgleich zum Hafermilch-Eklat von einem früheren Journalisten widerlegt, der sich im Ruhestand offenbar so sehr gelangweilt hatte, dass er sich für eine letzte Runde Applaus von Seiten der AfD und anderer Reaktionär-Katastrophen noch einmal in die Manege erbrach. Ich bin ja grundsätzlich bereit, über alles zu diskutieren, aber wenn im zweiten Absatz das Adjektiv „linksgrunzend“ auftaucht wie in einem „Welt“-Leser-Kommentar, was für eine Diskussionsgrundlage soll ich da noch annehmen? Dafür ist mir dann, Hashtag Work-Life-Balance, wirklich meine Lebenszeit zu kostbar.
Und dann ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass so ein bisschen Generationenkonflikt vielleicht gar nicht so schlecht ist — wie soll man denn sonst als Gesellschaft weiterkommen? Ich lese gerade endlich mal „Die Palette“ von Hubert Fichte; ein Buch, das 1968 erschienen ist. Und dann fiel mir auf: Dieses mystische Jahr 1968 ist vom Kriegsende so weit entfernt wie wir heute vom Jahr 2000. Das ist einige Krisen (9/11, Finanzkrise, Ukraine-Krieg, COVID-19-Pandemie) her, aber erscheint selbst mir, der ich damals 16 war, gar nicht so weit weg. Die 20-Uhr-„Tagesschau“ vom 14. August 2000 wurde von Jens Riewa verlesen und ihre Themen waren: das russische Militär, ein beleidigter Altkanzler, Rechtsextremisten im Internet, besserer Mobilfunk, Umweltschutz und Nordkorea. (Okay, das war jetzt der Pointe wegen etwas vereinfacht. Es ging um den Untergang des russischen Atom-U-Boots „Kursk“, die Nicht-Teilnahme von Helmut Kohl an der Feier zum Tag der deutschen Einheit, ein geplantes NPD-Verbot, die Versteigerung der UMTS-Lizenzen, die Schließung einer Bleischmelze im Nordkosovo, die Verbindungsbüros zwischen Nord- und Südkorea und noch einige andere Themen wie die vorzeitige Haftentlassung des Kaufhaus-Erpressers „Dagobert“.)
Wenn Menschen und Medien heute – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer Anekdote wie dem Auftritt von Lanz und Precht – behaupten, eine solche gesellschaftliche Spaltung habe es noch nie gegeben, bestätigt das einmal mehr meine These, dass wir in Deutschland mehr Geschichtsunterricht brauchen: Stichwort Wiederbewaffnung, Stichwort 1968, Stichwort RAF, Stichwort Umweltbewegung. Oder einfach überhaupt mal: Rock’n’Roll! (Oder, wie Thomas Gottschalk es nennt: „Noch richtige Musik.“) Das waren noch Konflikte, die Familien auseinandertrieben!
Deutschland ist in 16 Jahren unter Angela Merkel so durchschnittlich und lauwarm geworden, dass es manchen Leuten als linksradikal gilt, die Umbenennung fragwürdiger Straßennamen zu fordern, und als rechts, Fleisch zu essen. Auch, weil jede Nischen-Position (von denen es immer schon viele gab) heute medial aufgeblasen und zur Glaubensfrage hochphantasiert wird. Und war nicht meine Generation, die Generation Y, am Ende viel zu nett? Da ist es doch gut, wenn die Generation Z jetzt mal ein bisschen auf den Tisch haut! Für Leute wie Lanz, Precht oder Schmidt sind wir wahrscheinlich eh alle eine uniforme, irgendwie „jüngere“ Masse, die in geschlechtsneutralen Badezimmern mit Asterisken und Hafermilch die deutsche Wirtschaft schwächen.