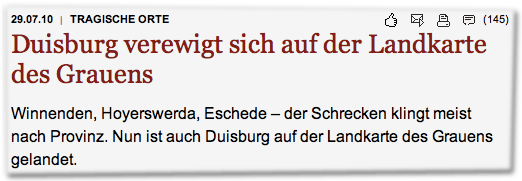Ich weiß noch, wie ich im Februar 2006 mit einer Kollegin unterwegs war, sie einen offenbar unspektakulären Anruf bekam, aber hinterher sagte: „Jedes Mal, wenn meine Mutter anruft, denke ich, es ist was mit Omma!“ Damit fasste sie etwas in Worte, was ich auch schon unterbewusst gedacht hatte, und was ich seitdem immer wieder dachte, wenn mein Handy anzeigte, dass meine Eltern anriefen.
Ich weiß im Gegensatz dazu nicht so genau, wann das angefangen hat, dass ich an Weihnachten und den Geburtstagen meiner Großeltern dachte: „Ich fahr mal lieber nach Dinslaken; wer weiß, wie oft wir das noch zusammen feiern?“, aber auch das muss jetzt über zehn Jahre her sein.
Drei Anrufe hatte ich schon bekommen (alle auf dem Festnetztelefon): im Juli 2012, als mein entfremdeter Großvater gestorben war, ein Mann, den ich zuletzt Mitte der 1990er Jahre gesehen hatte und den ich in der Stadt nicht erkannt hätte, wenn wir uns begegnet wären; im August 2017, als meine Großmutter mütterlicherseits nach einer Operation im Krankenhaus starb, zu der sie sich mit den Worten verabschiedet hatte, es wäre nicht schlimm, wenn das jetzt schief ginge, wir bräuchten nicht traurig zu sein, es sei dann auch gut gewesen; Ende Dezember 2017, 96 Stunden nachdem wir mit unserem Großvater väterlicherseits noch einmal Weihnachten gefeiert und geahnt hatten, dass es das letzte Mal sein würde, aber noch an ein letztes gemeinsames Osterfest geglaubt hatten.
Aber eine Großmutter war ja immer noch da, so wie sie immer dagewesen war: Omi, von der wir zwölf Enkelkinder wirklich fast immer nur als Omi sprachen — so als gäbe es nur eine einzige auf der Welt; die anderen bekamen ihren Namen angehängt, aber „Omi Sigrid“ sagten wir wirklich selten, es war doch eh klar, von wem wir sprachen.
Mit jedem Geburtstag und jedem Weihnachtsfest sank – die trockenen Zahlen betrachtet – die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Jahr noch einmal gemeinsam feiern können würden. In den Seuchenjahren 2020 und ’21 schafften wir es immerhin, ihren Geburtstag auf der Terrasse zu feiern; mit Masken und Abstand, aber auch mit Sekt, so wie es sich gehörte. 2020 saßen wir an Weihnachten vor dem Tablet und winkten nach Dinslaken, in der Hoffnung, dass die Pharmaindustrie schnell genug sein würde, damit wir eine geimpfte Omi noch einmal in den Arm nehmen könnten. Vielleicht sogar zu Weihnachten. Und auch wenn es 2021 keine Feier in ihrem engsten Familienkreis (Stand damals: 43 Personen) mehr gab, weil es einfach zu viel gewesen wäre und sie in großen Gruppen nicht mehr gescheit zuhören konnte, so waren wir im Laufe der Feiertage doch fast alle noch mal bei ihr im Wohnzimmer, aßen Lebkuchen, die sie selbstverständlich selbst aus der Küche geholt hatte, denn davon würde sie sich niemals abbringen lassen, und genossen das Geschenk, allen Widrig- und Wahrscheinlichkeiten zum Trotz, noch einmal Weihnachten mit Omi verbringen zu dürfen.
Im Juni wurde Omi – für uns Enkelkinder: plötzlich; für ihre Kinder, die sie Tag für Tag besuchten und umsorgten: absehbar – schwächer. Auf einmal schien die entscheidende Frage, ob wir es noch mal an ihr Bett nach Dinslaken schaffen würden; ihr eine Sonnenblume hinstellen könnten; noch einmal mit ihr sprechen und uns bedanken können würden. Wir konnten. Es wurden noch einige Sonnenblumen und Gespräche und Ende August saß sie an ihrem 96. Geburtstag wie selbstverständlich auf der Terrasse, ließ Gesänge und Lobpreisungen eher widerwillig über sich ergehen, freute sich über neugeborene Urenkelinnen und fast 80-jährige Nichten, die zu Besuch gekommen waren, und erhob natürlich das obligatorische Glas Sekt.

Wenn ich in den letzten Jahren die Todesanzeigen in der Zeitung studierte (was ich aus einer Mischung aus „Memento mori“ und „Ich könnte ja jemanden kenne“ regelmäßig tue), vergingen inzwischen manchmal ganze Monate, ohne dass auch nur eine einzige verstorbene Person älter als Omi gewesen wäre. In die Nachrichten schafften es immerhin Betty White, Queen Elizabeth II und Angela Lansbury, die allesamt älter waren (wenn auch zum Teil nur wenige Monate). Eingedenk der Weltlage erschien es mir irgendwann zumindest theoretisch möglich, dass wir uns nie von Omi verabschieden müssen würden, sondern einfach alles vor ihr endet.
Nun: Der Anruf kam am Abend des 25. Oktober 2022. Nach Tagen, an denen sie nicht mehr gegessen und getrunken hatte, war Omi – man soll diese Formulierung in der Gegenwart von Kindern vermeiden, denn Tote sind tot, sie können nicht wieder aufwachen; aber hier trifft sie dann eben doch mal in einem weniger als 50% metaphorischen Sinne zu – friedlich eingeschlafen.
Ich glaube, es war Thees Uhlmann, der mal gesagt hat, dass man versuchen sollte, Denkmäler für die Menschen zu errichten, denen sonst keine Denkmäler gebaut werden. Also habe ich bei Instagram versucht, in Worte zu fassen, was Omi, ihre Süßigkeiten, ihre Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe und ihr Glaube für mich bedeutet haben und immer bedeuten werden. Ich hab bei ihrem Beerdigungskaffeetrinken eine kleine Ansprache gehalten, in der ich versucht habe, ihr Leben (oder wenigstens die 39 Jahre, die ich mit ihr verbringen durfte) zu würdigen. Ich wusste vorher schon: Ich könnte ein Buch schreiben über Omi, unsere Familie und das Ruhrgebiet, dessen Geschichte so eng mit der unserer Familie verwoben ist. Und damit fange ich jetzt an!
Dieser Text erschien ursprünglich in meinem Newsletter “Post vom Einheinser”, für den man sich hier anmelden kann.




 Konrad Lischka und Frank Patalong stammen auch aus dem Ruhrgebiet. Lischka ist 32 und in Essen aufgewachsen, Ptalaong 48 und aus Duisburg-Walsum. Heute arbeiten beide bei “Spiegel Online” in Hamburg, aber sie haben ein Buch geschrieben über die “wunderbare Welt des Ruhrpotts”: “Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach”.
Konrad Lischka und Frank Patalong stammen auch aus dem Ruhrgebiet. Lischka ist 32 und in Essen aufgewachsen, Ptalaong 48 und aus Duisburg-Walsum. Heute arbeiten beide bei “Spiegel Online” in Hamburg, aber sie haben ein Buch geschrieben über die “wunderbare Welt des Ruhrpotts”: “Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach”.