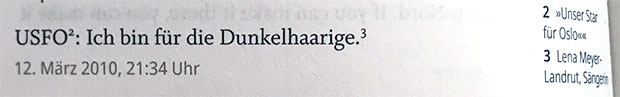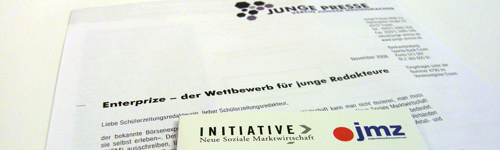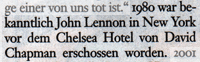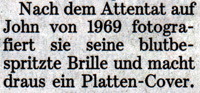Manche Dinge sind nur schwer zu erklären: die Abseitsregel angeblich, der Erfolg von Modern Talking oder alles, was mit dem sogenannten Web 2.0 zu tun hat. Wer einmal versucht hat, seinen Großeltern das Konzept eines Blogs oder gar die Funktionsweise von Twitter zu erklären, kennt danach alle Metaphern und Synonyme der deutschen Sprache.
Zu den Dingen, die für Außenstehende (aber nicht nur für die) unverständlich erscheinen, gehört die Bereitschaft junger Menschen, privateste Dinge im World Wide Web preiszugeben. Bei MySpace, Facebook, LiveJournal, StudiVZ und ähnlichen Klonen teilen sie theoretisch der ganzen Welt ihr Geburtsdatum, ihre Schule und ihre sexuelle Orientierung mit und bebildern das Ganze mit jeder Menge Fotos, auf denen sie – wenn man der Presse glauben schenken darf – mindestens betrunken oder halbnackt sind, meistens sogar beides.
In der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” von gestern war ein großer Artikel von Patrick Bernau zu dem Thema – interessanterweise im Wirtschaftsteil. Dort geht es hauptsächlich um die personalisierten Werbeanzeigen, die StudiVZ, Facebook und die “Hallo Boss, ich suche einen besseren Job!”-Plattform Xing zum Teil angekündigt, zum Teil eingeführt und zum Teil schon wieder zurückgenommen haben. Bernau montiert die Auskunftsfreudigkeit der User gegen die Proteste gegen die Volkszählung vor zwanzig Jahren, er hätte aber ein noch größeres scheinbares Paradoxon finden können: die Proteste gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Gelegentlich frage ich mich selbst, warum ich einerseits so entschieden dagegen bin, dass Polizei und Staatsanwaltschaft im Juli nachgucken könnten, wen ich gestern angerufen habe (sie brauchen nicht nachzugucken: niemanden), ich aber andererseits bei diversen Plattformen und natürlich auch hier im Blog in Form von Urlaubsfotos (also Landschaftsaufnahmen), Anekdoten und Meinungen einen Teil meines Lebens und meiner Persönlichkeit einem nicht näher definierten Publikum anbiete. Aber erstens halte ich Auskünfte über meine Lieblingsbands und -filme oder die Tatsache, dass ich Fan von Borussia Mönchengladbach bin, für relativ unspektakulär (ich drücke diese Präferenzen ja auch durch das Tragen von entsprechenden T-Shirts öffentlich aus), und zweitens gebe ich diese Auskünfte freiwillig, ich mache von meinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gebrauch.
Wenn also beispielsweise die Juso-Hochschulgruppe Bochum auf einem Flugblatt angesichts der personalisierten Werbung im Web 2.0 fragt:
Muss der Staat eingreifen? Wie weit darf die “Marktwirtschaft 2.0” gehen?
und dann auch noch “SchnüffelVZ” und Vorratsdatenspeicherung bei einer Podiumsdiskussion gemeinsam behandeln will, weiß ich schon mal, welcher Liste ich bei der Wahl zum “Studierendenparlament” nächste Woche meine Stimme nicht gebe. ((Nicht, dass nach der großen Geldverbrennungsaktion des Juso-AStAs noch die Gefahr bestanden hätte, diesem Haufen mein Vertrauen auszusprechen, aber doppelt hält besser.))
Ich habe ein wenig Angst, wie die FDP zu klingen, aber: Die Mitgliedschaft in der Gruschelhölle oder beim Freiberufler-Swingerclub Xing ist freiwillig, niemand muss dort mitmachen, niemand muss dort seine Daten angeben. Sie ist darüberhinaus aber auch kostenlos (Xing gibt’s gegen Bares auch als Premium-Version, aber das soll uns hier nicht stören) und wird dies auf lange Sicht nur bleiben können, wenn die Unternehmen über die Werbung Geld verdienen. Und warum personalisierte Werbung effektiver (und damit für den Werbeflächenvermieter ertragreicher) ist, erklärt der “FAS”-Artikel in zwei Sätzen:
Wenn zum Beispiel nur die angehenden Ingenieure die Stellenanzeigen für Ingenieure bekommen, bleiben die Juristen von den Anzeigen verschont. Wenn ein beworbenes Rasierwasser schon zur Altersgruppe passt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dem Nutzer tatsächlich gefällt.
Ob ich nun nach der einmaligen postalischen Bestellung bei einem Musikinstrumentenversand unaufgefordert die Probeausgabe einer Musikerzeitschrift im Briefkasten habe, oder ein wenig automatisch erzeugte Digitalwerbung auf meinem Monitor, macht qualitativ kaum einen Unterschied. Wenn mich das nervt oder mir meine hinterlegten Daten zu ungeschützt erscheinen, kann ich mich ja bequem zurückziehen – dann allerdings sollte ich auch die Möglichkeit haben, meine Daten Rückstandslos entfernen zu lassen, diese Mindesterwartung habe ich an den Plattform-Anbieter.
Wir brauchen also viel weniger einen staatlichen Eingriff (obwohl die Vorstellung, dass Bundesjustizministerin Brigitte Zypries im Fernsehen erklären soll, was denn so ein “social network” ist, durchaus einen erheblichen Trash-Charme hat) und viel mehr Medienkompetenz. Die kommt freilich nicht von selbst, wie man auch am Super-RTL-Kritiker Günther “Scheiß Privatfernsehen!” Oettinger sehen kann. Medienkompetenz könnte auch nicht verhindern, dass von ein paar Millionen Computerspielern und Horrorfilm-Zuschauern zwei, drei Gestörte auf die Idee kommen, das Gesehene nachzuahmen, aber sie könnte Jugendliche wenigstens so weit bringen, dass diese das Für und Wider von Betrunken-in-Unterwäsche-im-Internet-Fotos abwägen könnten.
Aber auch bei dem Thema sehe ich noch Verständnisschwierigkeiten: Wenn Mädchen und junge Frauen in ihren Fotogalerien bei MySpace oder Facebook Bikini- oder Unterwäschebilder von sich reinstellen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie von einer Karriere im Pornogeschäft träumen, wie es für manche Beobachter aussehen mag. Zwar lässt sich bei ein paar Millionen Mitgliedern nicht ausschließen, dass darunter auch ein paar Perverse sind, aber die Bilder dienen ja ganz anderen Zwecken: sich selbst zu zeigen ((Und ich höre mich mit bebender Stimme rufen: “Wir sollten in Zeiten von Magerwahn froh sein, wenn unsere Töchter so zufrieden mit ihrem Körper sind, dass sie ihn im Internet zeigen!”)) und den Herren in der peer group gefallen.
Nacktfotos von sich selbst hat bestimmt jede zweite Frau, die heute zwischen 18 und 30 ist, schon mal gemacht – mindestens, denn die Digitaltechnik vereinfacht auch hier eine Menge. Ob sie die ins Internet stellt und vielleicht sogar bei SuicideGirls oder ähnlichen Seiten Karriere macht ((Ich finde SuicideGirls ziemlich spannend und sehe darin eine geradezu historische Möglichkeit weiblicher Selbstbestimmung, doch das vertiefen wir ein andermal.)), sollte sie natürlich auch vor dem Hintergrund der angestrebten Berufslaufbahn (“Frollein Meier, mein großer Bruder hat sie nackt im Internet gesehen!”), ihres Selbstverständnisses und des Risikos der Belästigung gut abwägen. In jeder Kleinstadt gibt es ein Fotostudio, das im Schaufenster mit schwarz-weißen Aktfotos irgendeiner Dorfschönheit wirbt – diese Bilder sind oft von geringer künstlerischer Qualität und sind Lehrern, Nachbarn und gehässigen Mitschülern oft viel leichter zugänglich als MySpace-Fotos.
Auch Bilder von Alkoholgelagen gibt es, seit die erste Kleinbildkamera auf eine Oberstufenfahrt mitgenommen wurde. Ob Kinder ihren betrunkenen Vater mit Papierkorb auf dem Kopf im Wandschrank einer Münchener Jugendherberge ((Ich habe eine blühende Phantasie, müssen Sie wissen.)) nun zum ersten Mal sehen, wenn er zum fünfzigsten Geburtstag von seinen Alten Schulfreunden ein großes Fotoalbum bekommt ((Alles ausgedacht!)), oder sie die Fotos jederzeit im Internet betrachten können, ist eigentlich egal. Nicht egal ist es natürlich, wenn die Abgebildeten ohne ihre Einwilligung im Internet landen oder die Bilder jemandem zum Nachteil gereichen könnten.
Doch auch das wird auf lange Sicht egal werden, wie Kolumnist Mark Morford letztes Jahr im “San Francisco Chronicle” schrieb:
For one thing, if everyone in Generation Next eventually has their tell-all MySpace journals that only 10 friends and their therapist are forced to read, then soon enough the whole culture, the entire workforce will mutate and absorb the phenomenon, and it will become exactly no big deal at all that you once revealed your crazy love of pet rats and tequila shooters and boys’ butts online, because hell, everyone revealed similar silliness and everyone saw everyone else’s drunken underwear and everyone stopped giving much of a damn about 10 years ago.
Es wird zukünftigen Politikern vermutlich nicht mehr so gehen wie Bill Clinton, der irgendwann mit nicht-inhalierten Joints konfrontiert war, oder Joschka Fischer, dessen Steinwurf-Fotos nach über dreißig Jahren auftauchten: Über wen schon alles bekannt (oder zumindest theoretisch zu ergoogeln) ist, der muss keine Enthüllungen oder Erpressungen fürchten. Auch die Bigotterie, mit der Menschen, die ihre eigenen Verfehlungen geheimhalten konnten, anderen dieselben vorhalten, könnte ein Ende haben. Und das Internet könnte über Umwege tatsächlich zur Gleichmachung der Gesellschaft beitragen.
Nachtrag 16. Januar: Wie es der Zufall so will, hat sich “Frontal 21” dem Thema gestern angenommen. Wenn man die übliche Weltuntergangsstimmung und die Einseitigkeit der Expertenmeinungen ausklammert, ist es ein recht interessanter Beitrag, den man sich hier ansehen kann.