Ich habe das mit dem Angebot und der Nachfrage im Boulevardjournalismus noch nie geglaubt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich morgens nach dem Aufstehen fragen, was eigentlich Brad Pitt und Angelina Jolie gerade machen. Ich denke nicht, dass man Klatschzeitschriften und Gossip-Blogs erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass sich die Gedanken von älteren Menschen in Arztwartezimmern automatisch um das (vermeintliche) Privatleben von Volksmusikanten drehen würden, wenn es die entsprechenden Quatschmagazine nicht gäbe.
Entsprechend glaube ich auch nicht, dass Jugendzeitschriften die existentiellen Fragen von Jugendlichen beantworten — außer vielleicht auf den Seiten, wo sie die existentiellen Fragen von Jugendlichen beantworten.
Für einen Tag am Baggersee war mir aber nach leichter Lektüre, weswegen ich beherzt zum Zentralorgan für existentielle Fragen von Jugendlichen griff: zur “Bravo”.

Warum nicht gleich: “Zombies! Aliens! Vampire! Dinosaurier!”?
Jetzt fragen Sie sich als ungebildete, greise Leser dieses Blogs natürlich erst mal, wer dieses unbekannte Kind da auf der Titelseite überhaupt ist. Das ist Selena Gomez, die Hauptdarstellerin der Disney-Channel-Serie “Die Zauberer vom Waverly Place”, die Sie kennen könnten, wenn Sie Ihren minderjährigen Kindern erlauben, Super RTL zu gucken. Frau Gomez ist 18 Jahre alt und seit kurzem mit Justin Bieber liiert, dem womöglich größten Popstar unserer Tage. Aber das lassen Sie sich womöglich tatsächlich am Besten alles von irgendeinem Kind erklären — viele Eltern freuen sich ja, wenn man ein solches einfach mal für ein paar Stunden ausleiht (nachdem man vorher um Erlaubnis gefragt hat).
Jedenfalls: Selena Gomez war kürzlich im Krankenhaus.
Was für ein Schock! Mit Blaulicht und Sirenen wird Selena Gomez Donnerstagnacht ins Providence Saint Joseph Medical Center in Burbank bei Los Angeles eingeliefert. Totaler Zusammenbruch! Unglaublich: Wenige Minuten zuvor ist das Super-Girl noch live auf Sendung — in der “Tonight Show” von Jay Leno im US-TV.
(Nein, die “Tonight Show” ist natürlich nicht live.)
Nun könnte man annehmen, dass der Körper einer 18-Jährigen, die seit vier Jahren für eine Serie vor der Kamera steht, die diverse Promo-Auftritte absolviert und noch dazu auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt wird, irgendwann einfach mal schlapp macht. Nette Idee, aber es gibt doch noch ein paar andere:
Erste Erklärung: Falsche Ernährung soll schuld sein. Aber die Gerüchteküche brodelt. Waren vielleicht noch ganz andere Faktoren im Spiel?
 Zum Beispiel Zombies, Alie… Nein, nein. “Bravo”-Reporter Frank Siering (der von Los Angeles aus etwa jedes zweite deutsche Medium mit Hollywood-Geschichten beliefert) hat sich ja nicht umsonst vor “Sels Krankenhaus” fotografieren lassen, er hat sich “auf Spurensuche” begeben und herausgefunden, was “wirklich in jener Nacht passierte”. So fand er heraus, dass Selena Gomez “direkt nach der Live-Sendung” ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sie sich “immer wieder” an den Bauch gefasst habe und sie sich “gleich nach der Ankunft” setzen musste, “weil ihr so übel ist”. Sogar die Nummer des Einzelzimmers (“auf der 3. Etage des Krankenhauses mit Blick auf die Berge”) hat Siering herausgefunden — und wenn sie stimmt, ist ihm damit ein investigativer Coup gelungen, denn außer der “Bravo” kennt und nennt sie kein anderes Medium.
Zum Beispiel Zombies, Alie… Nein, nein. “Bravo”-Reporter Frank Siering (der von Los Angeles aus etwa jedes zweite deutsche Medium mit Hollywood-Geschichten beliefert) hat sich ja nicht umsonst vor “Sels Krankenhaus” fotografieren lassen, er hat sich “auf Spurensuche” begeben und herausgefunden, was “wirklich in jener Nacht passierte”. So fand er heraus, dass Selena Gomez “direkt nach der Live-Sendung” ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sie sich “immer wieder” an den Bauch gefasst habe und sie sich “gleich nach der Ankunft” setzen musste, “weil ihr so übel ist”. Sogar die Nummer des Einzelzimmers (“auf der 3. Etage des Krankenhauses mit Blick auf die Berge”) hat Siering herausgefunden — und wenn sie stimmt, ist ihm damit ein investigativer Coup gelungen, denn außer der “Bravo” kennt und nennt sie kein anderes Medium.
Mehr noch:
Wegen der starken Unterleibsschmerzen wird ein Frauenarzt zurate gezogen und sofort ein Schwangerschafts-Test gemacht.
Der unbestimmte Artikel (“ein Schwangerschafts-Test”) ist offensichtlich ein Flüchtigkeitsfehler, denn “Bravo” weiß es eigentlich noch genauer:

Damit wären “wir” auch schon beim ersten Gerücht, dessen Dokumentation die “Bravo” sich auf die Fahnen geschrieben hat. Denn tatsächlich würde gerade “alles ganz gut zusammenpassen”: Das Pärchen (von Fans offenbar liebevoll “Jelena” genannt) habe immerhin gerade einen romantischen Liebes-Urlaub auf Hawaii verbracht.
Hatten sie dort ihr erstes Mal? Und ist dabei gleich das passiert, was jetzt viel vermuten?
Das wäre, so “Bravo”, gar nicht “so abwegig”. Zwar hat das Teenie-Magazin kein blutiges Bettlaken, das sie abdrucken kann, aber eine schlüssige Indizienkette: Immerhin hätten auch die Mütter des Traumpaars ihre Kinder “extrem früh” bekommen.
Jus’ Mutter Pattie wurde mit 18 schwanger. Sels Mom Mandy sogar schon mit 15!
Für die Erkenntnis, dass Teenagerschwangerschaften erblich sind, dürfte mindestens ein Medizinnobelpreis fällig werden.
Aber weil so Klatschthemen ja vergleichbar mit Verschwörungstheorien sind – alle schreiben voneinander ab und der Umstand, dass die eigene Behauptung durch nichts gestützt wird, untermauert ihre Plausibilität nur noch mehr -, hat “Bravo” natürlich noch weitere Gerüchte in petto:
Könnte es sein, dass der Superstar von Hatern vergiftet wurde?
(“Hater” sind Menschen, die eine bestimmte Person überhaupt nicht ausstehen können. Im Deutschen würde man vielleicht “Blog-Kommentatoren” sagen.)
“Bravo” findet das “auch nicht unwahrscheinlich” und liefert eine erstaunliche Begründung:
Immerhin äußerten die Ärzte sofort den Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung! Dass ihr jemand absichtlich verdorbenes Essen verabreicht hat, konnte aber bislang nicht bewiesen werden.
Welch Glück, dass die Lebensmittelvergiftung so heißt. Schade hingegen, dass die “Bravo” kein Foto gefunden hat, auf dem Selena Gomez einen “Gift Shop” verlässt.
Für die Gift-Theorie spricht laut “Bravo” alles, was dagegen spricht:
Und Selena selbst will das Ganze verharmlosen: “Ich habe nur zu viel Ungesundes gegessen.”
Womöglich ein erstes Anzeichen für das Stockholm-Syndrom.
Und damit zu Gerücht Nummer drei, das die “Bravo” ein bisschen widerwillig aufzugreifen scheint:
Hatte Sel einen Schwächeanfall, weil sie zu viel arbeitet?
Steile These, für die nur … alles spricht, was “Bravo” so zu berichten weiß.
Sels Mom macht sich jedenfalls große Sorgen: “Sie will einige Termine streichen, um ihre Tochter zu entlasten”, verrät ein Freund der Familie.
Wie so ein “Freund der Familie” aussieht, hat der Wortvogel vor einiger Zeit schon mal so erklärt:
In der Welt der Klatschpostillen gibt es mehr imaginäre Freunde als in einem Hort voller hyperaktiver Vierjähriger.
Fassen wir also den Artikel, mit dem “Bravo” immerhin drei Heftseiten gefüllt gekriegt hat, noch einmal zusammen: Selena Gomez war kürzlich im Krankenhaus.

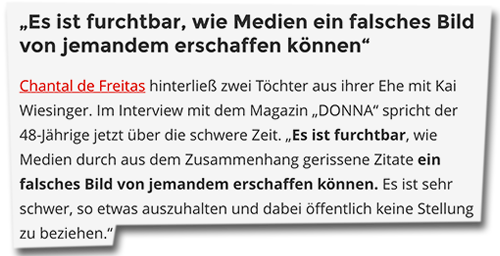



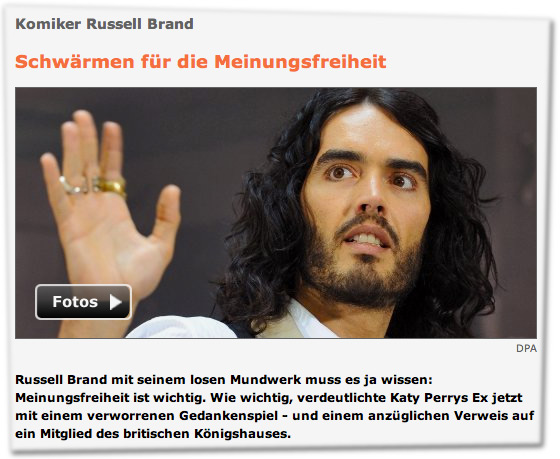




 Zum Beispiel Zombies, Alie… Nein, nein. “Bravo”-Reporter Frank Siering (der von Los Angeles aus etwa jedes zweite deutsche Medium mit Hollywood-Geschichten beliefert) hat sich ja nicht umsonst vor “Sels Krankenhaus” fotografieren lassen, er hat sich “auf Spurensuche” begeben und herausgefunden, was “wirklich in jener Nacht passierte”. So fand er heraus, dass Selena Gomez “direkt nach der Live-Sendung” ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sie sich “immer wieder” an den Bauch gefasst habe und sie sich “gleich nach der Ankunft” setzen musste, “weil ihr so übel ist”. Sogar die Nummer des Einzelzimmers (“auf der 3. Etage des Krankenhauses mit Blick auf die Berge”) hat Siering herausgefunden — und wenn sie stimmt, ist ihm damit ein investigativer Coup gelungen, denn außer der “Bravo” kennt und nennt sie kein anderes Medium.
Zum Beispiel Zombies, Alie… Nein, nein. “Bravo”-Reporter Frank Siering (der von Los Angeles aus etwa jedes zweite deutsche Medium mit Hollywood-Geschichten beliefert) hat sich ja nicht umsonst vor “Sels Krankenhaus” fotografieren lassen, er hat sich “auf Spurensuche” begeben und herausgefunden, was “wirklich in jener Nacht passierte”. So fand er heraus, dass Selena Gomez “direkt nach der Live-Sendung” ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sie sich “immer wieder” an den Bauch gefasst habe und sie sich “gleich nach der Ankunft” setzen musste, “weil ihr so übel ist”. Sogar die Nummer des Einzelzimmers (“auf der 3. Etage des Krankenhauses mit Blick auf die Berge”) hat Siering herausgefunden — und wenn sie stimmt, ist ihm damit ein investigativer Coup gelungen, denn außer der “Bravo” kennt und nennt sie kein anderes Medium.





