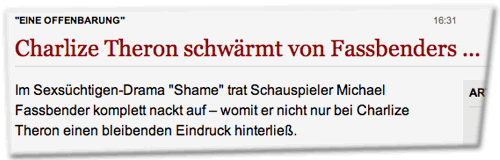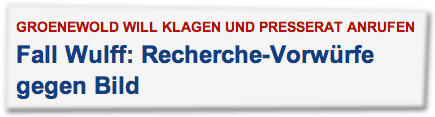Es gibt Texte, die neben ihrem eigentlichen Inhalt auch ihre eigene Entstehungsgeschichte transportieren. In der heutigen “Bild am Sonntag” gibt es mindestens zwei dieser Sorte:
Zehn Kollegen haben Stefan Hauck (der als Experte auf dem Gebiet der Existenzvernichtung zu gelten hat) bei seinem Versuch unterstützt, das Privatleben von Jörg Kachelmann auszuloten.
Sie haben dabei keine großen Erkenntnisse gewonnen und die Enttäuschung darüber schwingt mit:
Viel genauer geht es nicht, denn auch am Ende von langen Gesprächen mit Weggefährten, Freunden, Geliebten, Kollegen und Feinden des Beschuldigten, hat zwar jeder über Jörg-Andreas Kachelmann gesprochen – aber immer einen anderen Menschen geschildert.
Da betreibt man so einen Aufwand und am Ende sitzt man vor einem Berg aus Puzzleteilen, die alle nicht so rechtzusammenpassen wollen. Aber wenn man sie doch gewaltsam zusammenhämmert, entsteht da das Bild eines Menschen — oder, wie Hauck schreibt, einer “widersprüchlichen Person”.
“Herzlichen Glückwunsch!”, möchte man fast ausrufen, “Sie haben soeben begriffen, dass die wenigsten Menschen zweidimensionale Wesen sind!” Aber das wäre Quatsch. Hauck hat nichts begriffen, wie er gleich zu Beginn seines Textes selbst herausposaunt:
Bis vergangenen Montag hat sich kein Mensch ernsthaft dafür interessiert, was der Fernsehstar Jörg Kachelmann, 51, für eine Beziehung zu Frauen hat. Und ob überhaupt. Kachelmann ist ein Star des Fernsehens, ist aber, was den “Glam-Faktor” anbelangt, also die Maßeinheit, in der man das Glitzernde eines Fernseh-Menschen misst, natürlich kein Roberto Blanco, wer ist schon wie Roberto Blanco?
Wenn sich bis letzte Woche “kein Mensch ernsthaft” für das Intimleben dieses angeblich so unglamourösen Fernsehstars interessiert hat, warum sollte man es jetzt tun? Weil es helfen würde, als Außenstehender zu beurteilen, ob Kachelmann die Tat, die ihm vorgeworfen wird, begangen haben könnte? (Und was hat das Wort “ernsthaft” überhaupt in diesem Satz zu suchen?)
Die Suche nach Erklärungsmustern ist zutiefst menschlich, aber während es bei Amokläufern oder Terroristen, ((Der Kabarettist Volker Pispers sagte einmal über die Reporter, die nach den Anschlägen des 11. September 2001 in Hamburg das Umfeld des Anführers Mohammed Atta ausgefragt hatten: “Solche Menschen können Sie nur zufriedenstellen, indem Sie sagen: ‘Ja, so ein bisschen nach Schwefel gerochen hat er schon ab und zu.'”)) die ihre Taten in und an der Öffentlichkeit begangen haben, noch ein gerechtfertigtes Interesse an ihrer Vorgeschichte geben könnte – um im Idealfall in ähnlich gelagerten Fällen Taten zu vermeiden – geht es im “Fall Kachelmann” um das exakte Gegenteil: Ein mögliches Verbrechen im denkbar intimsten Rahmen, in dessen Folge nicht nur der mutmaßliche Täter der Öffentlichkeit präsentiert wird, sondern auch das potentielle Opfer, notdürftig anonymisiert.
* * *
Die andere Geschichte hat nur eine Autorennennung, aber schon der erste Satz deutet an, dass auch Nicola Pohl nicht allein war, als sie im privaten Umfeld der deutschen Grand-Prix-Hoffnung Lena Meyer-Landrut wühlte:
Einen wehmütigen Jungen mit dünnem Bart. Eine Tanzlehrerin, die abhebt. Einen Friseur, der der Neunjährigen die Spitzen schnitt. Sie alle trafen wir, als wir zwei Tage durch Lena Meyer-Landruts Leben spazierten und uns fragten: Wo lebt, lacht, liebt, lümmelt Lena?
Die Recherche muss noch enttäuschender verlaufen sein als die bei Kachelmann: Aus der Überschrift “Wie heil ist Lenas Welt?” tropft förmlich die Hoffnung auf Familiendramen, Drogen, Sex und Schummeln bei den Vorabiklausuren, aber nichts davon hat die Autorin gefunden. Jetzt muss sie unüberprüfbare und belanglose Aussagen wie “Für 7,90 Euro ließ sie sich Spitzen schneiden” als Sensations-Meldung verkaufen. Wenn man schon sonst nichts gefunden hat und extra hingefahren ist.
* * *
Mal davon ab, dass ein Friseur, der mit irgendwelchen wildfremden Menschen über mich redet, mir die längste Zeit seines Lebens die Haare geschnitten hätte, habe ich nie verstanden, was so interessant sein soll am Privatleben von Prominenten. Ich bin mir sicher, wenn man die Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder eines beliebigen Menschen befragt, werden die meisten nicht viel mehr als zwei, drei Sätze über die betreffende Person berichten können — wohl aber erstaunliche Details aus dem Privatleben von Brad Pitt, Angelina Jolie, Sandra Bullock und Tiger Woods.
Es ist mir egal, wie oft Ben Folds schon verheiratet war, welche Drogen Pete Doherty gerade nimmt und welche Haarfarbe Lily Allen im Moment hat. Ich wünsche diesen Prominenten wie allen anderen Menschen auch, dass es ihnen gut geht. ((Auch wenn Musiker meist die besseren Songs schreiben, wenn es ihnen schlecht geht, aber so egoistisch sollte man als Hörer dann auch nicht sein.)) Mich interessiert ja offen gestanden schon nicht, was die meisten Menschen so machen, mit denen ich zur Schule gegangen bin. ((Selbst einige Sachen, die mir gute Freunde über sich erzählt haben, hätte ich am liebsten nie erfahren. Aber mit dieser Last muss man in einer Freundschaft irgendwie klarkommen.))
* * *
Es sind Texte wie diese zwei aus “Bild am Sonntag”, bei denen man hofft, bei der Auswahl der eigenen Freunde das richtige Fingerspitzengefühl bewiesen zu haben, auf dass diese nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Journalisten plaudern, wenn man selbst mal zufälligerweise unter einen Tanklaster geraten sollte. Gleichzeitig ahnt man natürlich auch, dass die Menschen, die reden würden, nur das Schlechteste über einen zu berichten wüssten: Frühere Mitschüler, mit denen man nie etwas zu tun hatte; Ex-Kollegen, die man im Eifer des Gefechts mal eine Spur zu hart angegangen hat; Internet-Nutzer, die glauben, aufgrund der Lektüre verschiedener Blog-Einträge und -Kommentare einen Eindruck von der eigenen Person zu haben.
* * *
Überhaupt sollte man bei dieser Gelegenheit und für alle Zeiten noch mal auf den Ratgeber “Hilfe, ich bin in BILD!” zu verweisen, den die Kollegen vor mehr als drei Jahren zusammengestellt haben, aber der natürlich immer noch gültig ist, wenn “Bild”-Reporter, Menschen, die sich als solche ausgeben, oder andere Medienvertreter bei einem anrufen.
* * *
Wenn ein Verkehrsminister seinen Führerschein wegen Geschwindigkeitsüberschreitung abgeben muss, ist das eine interessante Information, weil seine private Verfehlung mit seinem öffentlichen Amt kollidiert. Wenn dagegen ein Landwirtschaftsminister beim Rasen erwischt würde, sähe ich keinen Zusammenhang zu seinem Amt und somit auch keinen Grund für öffentliche Verlautbarungen. ((Dass sich generell jeder an die Verkehrsregeln halten sollte, steht dabei außer Frage.))
Im Falle Kachelmann haben die Vorwürfe gegen ihn nichts mit seinem Beruf zu tun. Zwar ist es durchaus denkbar, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender auf die Dienste vorbestrafter Moderatoren verzichten würde (schon, um Schlagzeilen wie “Unsere Gebühren für den Vergewaltiger!” zu vermeiden), aber darüber kann die ARD ja immer noch entscheiden, wenn es ein rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts gibt.
Allein über die irrige (und oft gefährliche) Annahme, man müsse immer sofort losberichten, wenn man von einer Sache Wind bekommen hat, könnte ich mich stundenlang auslassen. Das Internet und der herbeiphantasierte Anspruch, man müsse nicht der Beste, sondern nur der Schnellste sein, hat Journalismus zu etwas werden lassen, was mit “work in progress” mitunter noch schmeichelhaft umschrieben wäre. “Work in preparation” wäre mitunter passender.
* * *
Von der Arbeitsweise mancher Medienvertreter konnte ich mich in den letzten Tagen selbst überzeugen, als mich ein Mitarbeiter der Zeitschrift “Der Journalist” anrief, die ausgerechnet vom Deutschen Journalisten-Verband herausgegeben wird: Es ging um Vorwürfe, ein Kollege, der auch für BILDblog schreibt, habe Zitate erfunden. Der Mann vom “Journalisten” wollte die Handy-Nummer des Kollegen, die ich ihm nicht geben konnte, und erklärte mir dann, er wolle auf alle Fälle erst mal mit dem Betroffenen selbst sprechen, bevor er etwas veröffentliche. Der Zeitdruck sei ja auch nicht sooo groß, zumal bei einer Monatszeitschrift.
“Das ehrt Sie schon mal”, hatte ich sagen wollen, es dann aber doch nicht getan, weil es mir albern erschien, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu loben. Glück gehabt, denn ich hätte mein Lob zurücknehmen müssen, wie sich alsbald zeigte.
* * *
Doch noch einmal zurück zu Jörg Kachelmann: Wenn sich die Redaktion der “Tagesschau” nach langen Diskussionen entscheidet, nicht über die Vorwürfe gegen ihn und seine Verhaftung zu berichten, kriegt sie dafür einen auf den Deckel.
Die selben Medien, die sich im Vergleich zum bösen, bösen Internet (das neben hundert anderen Gesichtern natürlich auch seine hässliche Fratze zeigt) immer wieder ihrer “Gatekeeper”-Funktion rühmen (die also wichtige von unwichtigen, richtige von unrichtigen Meldungen unterscheiden zu können glauben), haben ihre eigenen Scheunentore sperrangelweit offen und leiten ihre Verpflichtung (mit einer Berechtigung ist es nicht getan) zur Berichterstattung daraus ab, dass auch die Justiz aktiv geworden ist.
Franz Baden auf sueddeutsche.de:
Im Fall Kachelmann hat eine Frau Strafanzeige erstattet – und das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen, als sich der Tatverdacht erhärtet habe. Darüber wird berichtet werden müssen.
Wenn sich ein Journalist hinstellt und zu Besonnenheit aufruft, wie es Michalis Pantelouris in seinem Blog “Print Würgt” getan hat, kommt der Chefredakteur des Mediendienstes des Trash-Portals von Meedia.de vorbei und wirft ihm in einem Kommentar vor, solche Blogeinträge seien “rufschädigend für den Journalismus”.
Mir ist nach der letzten Woche ehrlich gesagt nicht ganz klar, auf was für einen Ruf er sich da eigentlich noch bezieht.