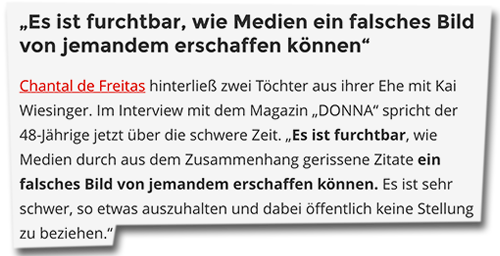Am 21. August wurde die ehemalige Soldatin Chelsea Manning, die der Whistleblower-Plattform Wikileaks geheime Dokumente zugespielt hatte, von einem US-Militärgericht zu 35 Jahren Haft verurteilt.
Wobei: Das stimmt so nicht. Damals hieß Chelsea in der Öffentlichkeit noch Bradley Manning und galt als Mann. Erst einen Tag später ließ sie ein Statement veröffentlichen, in dem es hieß:
As I transition into this next phase of my life, I want everyone to know the real me. I am Chelsea Manning. I am a female. Given the way that I feel, and have felt since childhood, I want to begin hormone therapy as soon as possible. I hope that you will support me in this transition. I also request that, starting today, you refer to me by my new name and use the feminine pronoun (except in official mail to the confinement facility).
Wer gleichermaßen aufgeklärt wie naiv ist, hätte annehmen können, dass das Thema damit schnell beendet war: Chelsea Manning ist eine Frau, die in einem männlichen Körper geboren wurde und einen männlichen Vornamen getragen hat, jetzt aber explizit darum bittet, mit ihrem weiblichen Vornamen bezeichnet zu werden.
Die “New York Times” erklärte dann auch in einem Blogeintrag, möglichst schnell den Namen Chelsea Manning und die weiblichen Pronomina verwenden und zum besseren Verständnis für die Leser auf die Umstände dieser Namensänderung zu verweisen. Der “Guardian” legte den Schalter von “Bradley” auf “Chelsea” um und schrieb fürderhin nur noch von “ihr”.
Aber so einfach war das alles natürlich nicht.
Die “Berliner Zeitung” fasste das vermeintliche Dilemma am 24. August eindrucksvoll zusammen:
Bradley Manning möchte fortan als Frau leben und Chelsea genannt werden. […] Der 25 Jahre alte Soldat ließ erklären, er habe sich seit seiner Kindheit so gefühlt. Von nun an wolle er nur noch mit seinem neuen Namen angesprochen werden. Auch solle künftig ausschließlich das weibliche Pronomen “sie” verwendet werden, wenn über Manning gesprochen werde. Eine operative Geschlechtsumwandlung strebt Manning zunächst wohl nicht an.
Mit diesem Wunsch hat Manning, der gut 700000 Geheimdokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergab, Journalisten in den USA verwirrt und vor große Herausforderungen gestellt. In den Meldungen über Mannings Erklärung war einmal von “ihm” die Rede, dann wieder von Bradley Manning, “die” nun eine Frau sein wolle. Die einen vermieden es peinlich, Personalpronomen zu verwenden. Die anderen erklärten, sie würden solange von “ihm” sprechen, wie Manning aussehe wie ein Mann.
Wie es die “Berliner Zeitung” selbst hält, wurde in den folgenden Wochen deutlich:
5. September:
Die von Matthew H. 2009 besuchte Veranstaltung des Chaos Computer Clubs war immerhin öffentlich. Sein Anteil an der Verurteilung des Whistleblowers Bradley Manning ist unklar. Und auch wenn der Umgang mit Manning nicht unseren Vorstellungen entspricht: Er hat militärische Geheimnisse verraten. Das ist auch deutschen Soldaten verboten.
6. September:
Wie in letzter Zeit in Berlin häufiger der Fall, stehen mal wieder leere Stühle auf der Bühne, diesmal nicht für den mit Ausreiseverbot belegten Filmemacher Jafar Panahi, sondern für Edward Snowden und Bradley Manning, die Ulrich Schreiber gern dabeigehabt hätte. Leider sind sie aus bekannten Gründen verhindert.
Bei der “Süddeutschen Zeitung” gibt es offenbar auch keine Empfehlungen und Richtlinien wie bei der “New York Times” — und noch nicht mal eine klare Linie. Am 2. September schrieb die “SZ”:
Auf Transparenten fordern die Teilnehmer, dass US-Präsident Barack Obama seinen Friedensnobelpreis an die Geheimdaten-Enthüller Chelsea Manning und Edward Snowden abtreten solle.
Und eine Woche später:
Anders gefragt: Hätten amerikanische Dienste eine solche Anfrage zugelassen, wenn ein deutscher Dienst sich um Hintergründe zum Treiben eines bekannten amerikanischen Journalisten interessiert hätte? Da können, trotz aller Narreteien und Verhärtungen der amerikanischen Politik im Kampf gegen Whistleblower wie Bradley Manning oder Edward Snowden amerikanische Behörden empfindsam reagieren.
Am 7. Oktober nun wieder:
Schließlich, so schreiben einige, sei er ein Visionär, gleichzusetzen mit der Wikileaks-Informantin Chelsea Manning oder dem NSA-Whistleblower Edward Snowden .
“Bild” hatte in ganz wenigen Zeilen klargemacht, wie wenig sich die Redaktion um die Bitte von Chelsea Manning schert: In ihren “Fragen der Woche” am 24. August fragte die Boulevardzeitung “Kommt Manning in den Frauenknast?” und antwortete:
Nein! Obwohl der zu 35 Jahren Gefängnis verurteilte Wikileaks-Informant Bradley Manning (25) ab sofort als Frau namens Chelsea leben und sich einer Hormonbehandlung unterziehen will (BILD berichtete), kam er in das Männergefängnis Fort Leavenworth (US-Staat Kansas). Ein Armeesprecher sagte, dass dort weder Hormontherapien noch chirurgische Eingriffe zur Geschlechtsumwandlung bezahlt werden.
Der Unterschied zum “Spiegel” ist da allerdings marginal:
Manning fühlt sich schon länger als Frau, nach seiner Verurteilung will er auch so leben. […] Am Mittwoch verurteilte ihn ein Militärgericht dafür zu 35 Jahren Gefängnis, abzusitzen in Fort Leavenworth, Kansas. Zwar kann Manning auf vorzeitige Entlassung hoffen – doch bis dahin steht ihm eine harte Zeit bevor: Seine Mitinsassen sind ausnahmslos Männer, eine Verlegung in ein Frauengefängnis ist nicht geplant.
Die Deutsche Presse-Agentur tat sich anfangs noch schwer mit dem Geschlecht. Am 4. September schrieb die dpa:
Die Mission des angeblichen US-Agenten soll dem Bericht zufolge öffentlich geworden sein, nachdem er im Juni dieses Jahres als Zeuge im Prozess gegen den Whistleblower Bradley Manning vor einem amerikanischen Militärgericht in Maryland aufgetreten sei. Manning wurde später zu 35 Jahren Haft verurteilt, weil er WikiLeaks rund 800.000 Geheimdokumente übergeben hatte. Der Ex-Soldat war eine Art Zeuge der Anklage der Militärstaatsanwälte.
Im Rahmen ihrer Berichterstattung zum Friedensnobelpreis letzte Woche schrieb die dpa dann:
Unter den bekannten Kandidaten in diesem Jahr ist auch Chelsea Manning (früher Bradley Manning). Dem einstigen US-Whistleblower räumt der Prio-Direktor aber wenig Chancen ein. “Es gibt keinen Zweifel, dass die Enthüllungen sehr zur internationalen Debatte über Überwachung beigetragen haben”, sagt Harpviken. Ethisch und moralisch reflektiere Manning aber zu wenig, was sie getan habe.
Tatsächlich hatte die Agentur in der Zwischenzeit die Entscheidung getroffen, zukünftig immer von “Wikileaks-Informantin Chelsea Manning” zu schreiben und im weiteren Textverlauf möglichst schnell zu erklären, dass Chelsea als Bradley Manning vor Gericht gestanden habe. Wie mir ihr Sprecher Christian Röwekamp auf Anfrage erklärte, hat die dpa nach Abstimmung mit anderen Agenturen am 6. September eine entsprechende Protokollnotiz in ihr Regelwerk “dpa-Kompass” aufgenommen, in dem sonst etwa die Schreibweisen bestimmter Wörter geregelt werden.
Der Evangelische Pressdienst epd war da offenbar nicht dabei. Er schrieb am 11. Oktober:
Gute Chancen auf den Friedensnobelpreis wurden auch dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton, dem WikiLeaks-Informanten Bradley Manning und der afghanischen Menschenrechtlerin Sima Samar eingeräumt.
Wie einfach es eigentlich geht, hatte die “FAZ” am 9. September bewiesen:
Der Umgang mit Chelsea (vormals Bradley) Manning, die Causa Snowden mit transatlantischer Sippenhaft gegen ihn unterstützende Journalisten und der Umgang mit den Geheimdienst- und Militär-Whistleblowern insgesamt zeigt überdeutlich, welch unkontrollierte Macht der “deep state” der Dienste mittlerweile hat und wie unberührt von öffentlichem Protest er agiert.
Am 5. Oktober schrieb die “FAZ” dann allerdings wieder:
Ohne die von Bradley Manning an die Enthüllungsplattform Wikileaks gelieferten geheimen Regierungsdokumente hätte Mazzetti manche Zusammenhänge nicht rekonstruieren können.
Nun zählen die Themenfelder Transgender und Transsexualität im Jahr 2013 immer noch zu den etwas außergewöhnlicheren, sind aber zumindest immer mal wieder in Sichtweite des Mainstreams. Balian Buschbaum etwa, der als Yvonne Buschbaum eine erfolgreiche Stabhochspringerin war, ist häufiger in Talkshows zu Gast und wird dort mehr oder weniger augenzwinkernd angelanzt, wie das denn jetzt so sei mit einem … hihi: Penis. Der Amerikaner Thomas Beatie durfte als “schwangerer Mann” die Kuriositätenkabinette der Boulevardmedien füllen. Mina Caputo wurde mal Keith genannt und war als Sänger von Life Of Agony bekannt und Laura Jane Grace von der Band Against Me! begann ihre Karriere als Tom Gabel — was die Komiker von “Spiegel Online” seinerzeit zu der pietätvollen Überschrift “Gabel unterm Messer” inspiriert hatte.
Viele haben in ihrem Bekanntenkreis keine Transmenschen (oder wissen nichts davon) und wissen nicht, wie sie mit einem umgehen sollten. Für Journalisten, die aus der Ferne über sie schreiben, ist es aber meines Erachtens erst einmal naheliegend, die Namen und Personalpronomina zu verwenden, die sich die betreffenden Personen erbeten haben. Und Chelsea Manning hat dies explizit getan.
In vergleichsweise alltäglichen Situationen scheinen Journalisten übrigens weniger überfordert: Muhammad Ali und Kareem Abdul-Jabbar waren schon bekannte Sportler, als sie zum Islam konvertierten und ihre neuen Namen annahmen. Durch Eheschließungen und -scheidungen wechselten Schauspielerinnen wie Robin Wright, Politikerinnen wie Kristina Schröder und Schmuckdesignerinnen wie Alessandra Pocher ihre Namen und die Presse zog mit. Und der Fernsehmoderator Max Moor hieß bis zum Frühjahr dieses Jahres Dieter, was – nach einem kurzen Moment des Naserümpfens und Drüberlustigmachens – inzwischen auch keinen mehr interessiert.
Hoffentlich braucht es weniger als 35 Jahre, bis Chelsea Mannings Bitte von den deutschen Medien erhört wird.