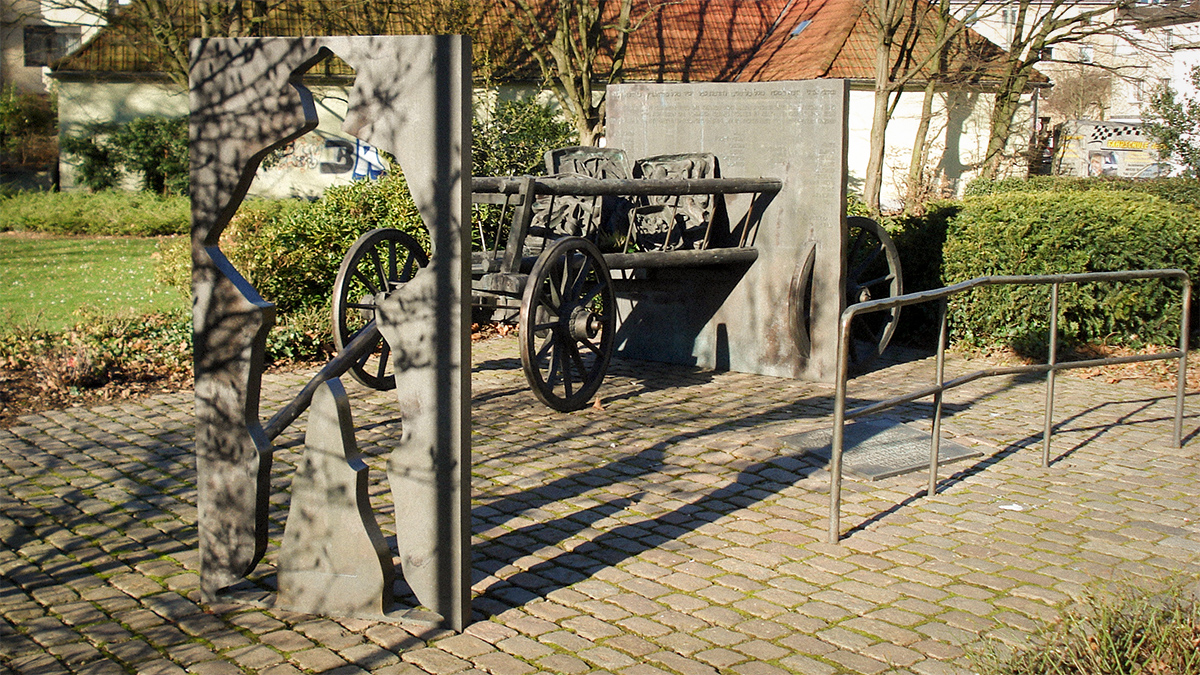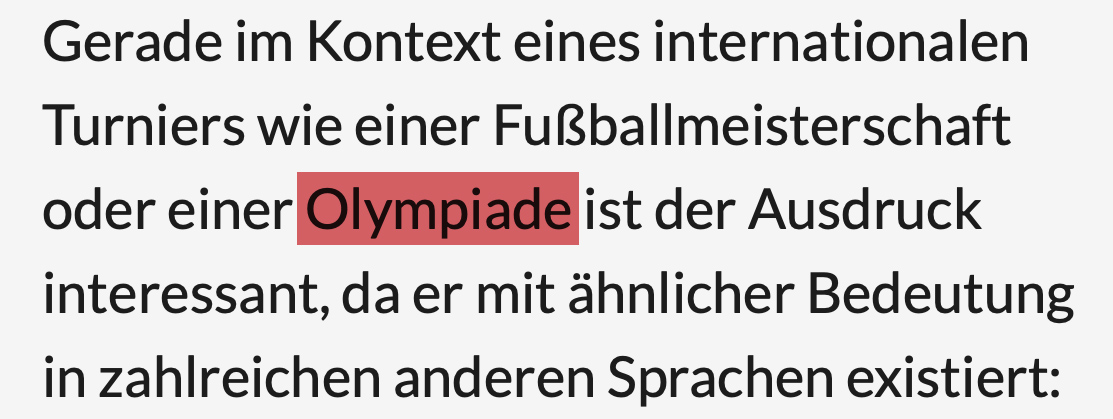In Zeiten wie diesen helfen ja vor allem Traditionen und Rituale: Jedes Jahr sitze ich also im Januar vor meinem MacBook, schiebe zunehmend hilflos Tracks in einer Spotify-Playlist hin und her und versuche, Hunderte Songs, die ich im vergangenen Jahr gehört habe, in irgendeine belastbare Reihenfolge zu bringen. Das neue Jahr kann, ja: darf, nicht richtig beginnen, ehe ich nicht das alte mit einer möglichst objektiven, allumfassenden Rückschau abgeschlossen habe.
Aus der ersten Kalenderwoche wird die zweite, dritte und vierte, langsam werde ich gestresst — und obwohl ich weiß, dass das hier niemand ernsthaft von mir erwartet, erscheint mir dieses Hobby-Projekt, das eigentlich harmlos, positiv und lebensbejahend sein sollte, zunehmend wie eine Last; eine Art musikalische Steuererklärung. Mehr noch: Weil ich weiß, dass ich mir diesen Druck ausschließlich selbst mache, habe ich besonders schlechte Laune — so einen intrinsischen Stress kenne ich von den anderen Männern in meiner Familie und dafür bin ich nicht in Therapie gegangen!
Dieses Jahr ist es zumindest ein bisschen anders: Ich habe mich Anfang Dezember bei Apple Music angemeldet — das ist ethisch immerhin ein bisschen besser zu vertreten als Spotify, außerdem ist die Soundqualität so viel besser, dass ich Anfangs dachte, ich hätte ein neues Paar Ohren, und alle meine Lieblingsalben erstmal neu – also quasi: zum ersten Mal – hören musste. Wenn man Musik die letzten 19 Jahre als MP3s mit 160 kb/s gehört hat, hat man keine Musik gehört!
Die anderen Probleme aber bleiben: So viele Songs, aber die meisten nicht öfter als drei, vier Mal gehört. Zumindest im Streaming — manche Songs habe ich bei BBC Radio 6 Music bestimmt 20, 30 Mal gehört und sie sind mir damit automatisch vertrauter, lieber und werden am Ende vermutlich höher gerankt werden. Und damit zeigt sich ja die ganze Absurdität der vermeintlichen Quali- und Quantifizierung: Es gehört ebenfalls zur Tradition, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt den Sinn des ganzen Unterfangens hinterfrage. Und wen genau will ich mit so einer Rangliste, die ich nun – mit Unterbrechungen – seit dem Jahr 2000 jedes Jahr anlege, eigentlich noch beeindrucken?
Mit zunehmendem Alter erscheint mir das Projekt also immer sinnloser und trotzdem mache ich erstmal weiter (was auch eine sehr schöne Beschreibung für das Konzept „Leben“ an sich wäre). Weil es mir eben auch hilft, zurückzublicken, zu sortieren, und so ein Jahr dann in einen Karton zu packen und ins Schwerlastregal zu stellen.
Wenn ich die großen Trends und Themen von 2025 herausarbeiten sollte, würde ich sagen: Die 1990er Jahre sind wieder da — und sie gehen nicht mehr weg. Von Britpop (und da rechnen wir die Oasis-Reunion und das neue Robbie-Williams-Album gleichen Namens nicht mit rein) über Alternative Rock ist alles zurück; junge Acts erinnern an Beck, Blur, Hole, Smashing Pumpkins und so weiter. Und was nicht nach den Neunzigern klingt, klingt nach The War On Drugs.
Ansonsten war ich stilistisch weit unterwegs: Ich sehe in meiner Liste neben Naheliegendem wie Indie, Americana und Electro auch französischen HipHop, Jazz, Klassik; ich zähle sechs deutschsprachige Songs (davon zwei in den Top 10), was es so vermutlich auch lange nicht mehr gegeben hat, zwei niederländische und was auch immer Rosalía da alles in „Berghain“ abfeuert. Zwei Cover-Versionen des gleichen Songs! Der längste Song ist 10:52 Minuten lang, der kürzeste 1:56.
Es sind 100 Songs, alle sehr gut, viele davon richtig, und ich hätte sicherlich noch viel mehr finden und auf die Liste packen können. Ihr könnt sie auf Shuffle hören, aber das hier sind – Stand Jetzt – meine Top 10 des Jahres 2025:
10. Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
Erst Anfang des letzten Jahres bin ich durch meinen Kumpel Stephan Kochs auf Jalen Ngondas Debüt-Album „Come Around And Love Me“ (Daptone; Apple Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Bandcamp) aus dem Jahr 2023 aufmerksam geworden — und da haben wir gleich einen weiteren Grund, diese ganzen Jahresbestenlisten in Frage zu stellen, denn im Nachhinein würde ich diese feine Soul/R&B/Motown-Platte gerne in meine Top 10 jenes Jahres packen (die allerdings eh nicht so richtig existiert).
Die gute Nachricht: Jalen Ngonda hat auch 2025 Musik veröffentlicht und „Just As Long As We’re Together“ ist Sonnenschein auf Vinyl (wenn man Musik noch auf Vinyl hört). Man ist sich beim ersten Hören sicher, diesen Song schon seit der eigenen Kindheit von Marvin Gaye, The Temptations, The Four Tops, The Spinners oder The Jackson 5 zu kennen, und stellt dann fest: Nee. Aber es fühlt sich genauso an!
9. Kae Tempest – Statue In The Square
Bis zum letzten Jahr war Kae Tempest immer nur am Rande meines Sichtfelds aufgetaucht: spannende Person (die Karriere begann weiblich gelesen, 2020 hatte Kae Tempest ein coming out als nicht-binäre Person, seit letztem Jahr spricht er von sich selbst als trans Mann), die Gedichte, Romane, Theaterstücke, Essays und eigentlich alle Arten von Texten schreibt, spannende Musik, aber näher beschäftigt hab ich mich nie damit.
Dann kam „Statue In The Square“, die erste Single des Albums „Self Titled“ (Island; Apple Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music): Breitbeinig stellt sich der Song konservativen Evolutionsbremsen und dem Narrativ eines reaktionären Backlashs entgegen; im Hintergrund schwillt ein Beat, irgendwie bedrohlich, aber mitreißend. „They never wanted people like me round here / But when I’m dead, they’ll put my statue in the square“, rappt Kae Tempest und errichtet denen, die nie reingepasst haben, die beäugt, verspottet und ausgegrenzt wurden, eigene Denkmäler. Eine Faust, die auf den Brustkorb trommelt, an der Stelle, wo das Herz ist.
8. KORD – Das ist nicht New York
Auf deutschsprachige Texten reagiere ich in aller Regel sehr körperlich: Entweder will ich mich vor lauter Fremdscham selbst entleiben oder mein Herz wird direkt freigelegt, weil es zu groß für meinen Brustkorb geworden ist.
„Das ist nicht New York“ von KORD fällt in letztere Kategorie. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Textstellen ich Gänsehaut bekomme. Es ist die Geschichte einer Kindheit in der deutschen Provinz im Wissen um das Konzept „USA“ (im Springsteen’schen Sinne, nicht im politischen) bei gleichzeitiger Negation desselben. Drauf gestoßen bin ich durch den Auftritt bei „Inas Nacht“, aber die ganze EP (Warner; Apple Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Deezer) gefällt mir sehr gut. Klingt, als hätte Adam Granduciel von The War On Drugs AnnenMayKantereit produziert, ist aber geil!
7. Clipping – Keep Pushing
Das einzige, was ich lange über Clipping, jenes experimentelles HipHop-Trio aus Kalifornien, wusste, war, dass Daveed Diggs, Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson aus „Hamilton“, dort seine maschinengewehrähnlichen rap skills abfeuert.
Dann kam „Keep Pushing“ als Vorab-Single ihres fünften Albums „Dead Channel Sky“ (Sub Pop Records; Apple Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Bandcamp): Ein hypnotischer Track, der sich immer weiter steigert und einen mitreißt wie in einen Strudel. Und jeder Strudel führt nach unten: Es ist ein Song darüber, in einer Welt, die um einen zerfällt, immer weiter zu machen. Wobei dieses „weiter machen“ im Text konkret bedeutet: Drogenhandel.
6. HAIM – Relationships
„Beziehungen: Oder soll man es lassen?“, ist eine Frage, die (meines Wissens, aber ich hab auch besseres zu tun) bisher noch kein Medium gestellt hat. Dabei gäbe es in Zeiten, in denen die körperliche Selbstbestimmung von Frauen in vielen US-Bundesstaaten wieder eingeschränkt wird; in denen das Muttchen am Herd als fragwürdiger Social-Media-Trend „Tradwife“ eine überraschende Renaissance feiert; in denen mehrere Studien zu dem Ergebnis kommen, dass die jüngste geschlechtsreife Generation, Z, weniger Sex hat als die Generationen vor ihr; in denen Paartherapeut*innen zu Social-Media-Stars werden, genug Anlässe, Beispiele und Gelegenheiten, mal intensiver über zwischenmenschliche Beziehungen nachzudenken.
HAIM machen das auf ihrem vierten Album „I Quit“ (Polydor; Apple Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music), über das ich für die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ geschrieben habe, unter vielen Aspekten; vor allem tun sie es in der ersten Single „Relationships“, die Jahrzehnte (ehrlicherweise: Jahrtausende, aber mit solchen Kategorien ist man ja hierzulande lieber vorsichtig) gesellschaftlicher Konventionen in Frage stellt und dabei so vergnügt klingt wie eine TLC-Single aus den 1990er Jahren: „Oh, this can’t just be the way it is / Or is it just the shit our parents did / And had to live with it in their relationship?“
5. Deep Sea Diver – Shovel
„Shovel“ von Deep Sea Diver aus Seattle wird schon deshalb immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil wir damit unsere kurzlebige Musik-Videoblog-Serie „5 Songs, die Ihr diesen Monat gehört haben solltet“ eröffnet haben.
Dieser Wechsel zwischen Strophe und Refrain, zwischen Selbstzweifeln und trotzig-optimistischem „It’s taken care of“ reißt mich auch ein Jahr später immer noch mit.
4. Lucy Dacus – Best Guess
Das ist einer dieser Songs, die bei BBC Radio 6 Music rauf- und runterliefen: Ein Liebeslied darüber, dass beide Partnerinnen altern werden; dass es vielleicht nicht für immer halten wird; darüber, was man sucht und findet, und dass letztlich alles, was mit der Zukunft zu tun hat, immer auch eine Wette ist.
So abgeklärte Gedanken zu einem wunderschönen, romantischen Lovesong zu formen, ist die große Stärke von Lucy Dacus. Nicht als trotzdem, sondern als deshalb. Was soll man denn auch sonst machen?
3. Taal – Schwerelos
Auf deutschsprachige Texten reagiere ich …
Sorry, ich komm noch mal rein: Taal sind ein junges FLINTA-Duo aus Köln. Clara hat schon unter dem Namen Maryaka Musik gemacht und in der allerallerersten Folge unserer kleinen Musiksendung haben wir Maryakas Song „Grow“ gespielt. Zusammen mit Tari ist Clara Taal und die beiden singen auf Deutsch über große Gefühle.
„Schwerelos“ ist erst ihre dritte Single, aber es war sehr, sehr unangefochten mein Sommerhit des Jahres 2025. „Bei Dir denke ich, ich kann das“, ist – hands down – eines der aufrichtigsten, passendsten und süßesten Komplimente, das je in einem Liebeslied gemacht wurde.
Textliche Versprechen knallen natürlich umso mehr, wenn sie auch musikalisch eingelöst werden — und hier ist tatsächlich alles schwerelos, indigo und so groß: Ältere werden sich an Wir Sind Helden oder Mia erinnert fühlen, ganz Alte vielleicht an Nena, es ist auch ein Hauch von The War On Drugs zu erkennen (wie eigentlich aktuell überall), vor allem ist es aber ein wunderschöner, unpeinlicher, queerer Lovesong!
Und wenn man einmal gesehen hat, wie Clara und Tari diesen Song live mit einer Choreo unterlegen, die man nur als „selbstbewusst awkward“ bezeichnen kann, wird die beiden eh sofort in sein Herz schließen!
2. Ider – Attachment Theory
Diese merkwürdigen neuen Veröffentlichungskonzepte mit „waterfall strategy“ und allem führen dazu, dass Du als Act in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in meinen Top 10 auftauchen kannst: Letztes Jahr waren Ider mit „You Don’t Know How To Drive“ auf Platz 6, jetzt sind sie mit „Attachment Theory“ auf Platz 2: Ein treibender Song über Beziehungen, Rollenbilder, Selbstermächtigung und darüber, aus alten Strukturen auszubrechen. (Ich merke gerade, dass mindestens die Hälfte meiner Top-10-Songs mit Beziehungen und Liebe zu tun haben. Weiß mein Musikgeschmack etwas, das ich nicht weiß?)
1. Wet Leg – Catch These Fists
Ich weiß noch ganz genau, wo und wie ich die ersten Takte von „Catch These Fists“ von Wet Leg zum ersten Mal bei „All Songs Considered“ gehört habe. Ich wusste schon nach drei, vier Tönen, dass mich dieser Song lange begleiten und vermutlich mein Song des Jahres werden wird. Es war früher Morgen, die Sonne schien und Heiko Butscher, der den VfL Bochum in der Saison 2023/24 völlig überraschend in der Bundesliga gehalten hatte, fuhr auf dem Fahrrad an mir vorbei.
2025 ist der VfL dann abgestiegen, aber dazu passt ein Song, der die ganze Zeit damit droht, einem eins aufs Maul zu geben, natürlich auch sehr schön: Rhian Teasdale und Hester Chambers von Wet Leg wissen jedenfalls, wie man einen Spannungsbogen aufbaut und so richtig schön auf die Hörer*innen draufknüppelt. Man down!
Und hier sind meine Top 100 — bei Apple Music:
Und auch noch mal bei Spotify: