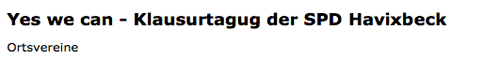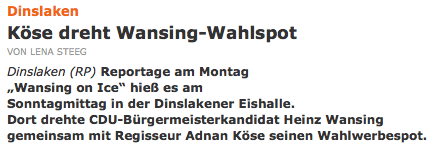Vorher laufen Songs von Taylor Swift. Ich bin wahnsinnig schlecht im Schätzen von Menschenmengen, aber es mögen schon an die 300 Leute sein, die da in der Bochumer Innenstadt auf dem Dr.-Ruer-Platz, benannt nach einem früheren jüdischen Oberbürgermeister, der von den Nazis in den Suizid getrieben wurde, in der prallen Mittagssonne stehen und warten.
Fast scheint es denkbar, dass das alles, die Musik und das überwiegend junge Publikum, nur hier ist, damit die Lokalpresse später schreiben kann, Heidi Reichinnek sei „empfangen worden wie ein Popstar“. Und tatsächlich hat die 37-Jährige, seit der Bundestagswahl Gesicht und Stimme der Linken, das Wirken junger, erfolgreicher Frauen in der Popkultur beobachtet und verstanden, während man beim Rest der bundesdeutschen Politik immer das Gefühl hat, irgendwo zwischen Andreas Gaballier, Heinz-Rudolf Kunze und The BossHoss rumzugründeln. Zumal, seit Robert Habeck, der Herbert Grönemeyer der Politik, das Gebäude verlassen hat.
Ein Mann wirft kleine Tütchen in die Menge; für einen Moment ist unklar, ob es sich um Gummibärchen oder Kondome handelt. Es sind Gummibärchen. Wenn sie vegan sind, könnte sich Ulf Poschardt trotzdem empören. Wenn sie nicht vegan sind, würden die Fans – und so kann man die Allermeisten hier wohl bezeichnen – sicherlich ein Auge zudrücken.
Das Publikum ist natürlich so, wie man es sich an einem Werktag in den Schulferien um 13:30 vorstellt: Sehr viele junge Menschen, aber nicht nur Schüler*innen. Es gibt sie noch, die schwarzen Punk-Rucksäcke mit vielen Buttons dran; dazu viele Hipster aus dem Ehrenfeld oder der Speckschweiz, die ausstrahlen, dass sie es zeitlich einrichten konnten, den Co-Working-Space oder Third-Wave-Coffeeshop vorübergehend zu verlassen; dazu die erwartbaren Veteran*innen von Hofgarten, Startbahn West und Wackersdorf.
Bevor es wirklich losgehen kann, bittet Ratsmitglied Horst Hohmeier darum, Rettungswege freizuhalten und sich „mehr in die Mitte zu orientieren“. Entschuldigung, wir sind doch hier, weil das mit der Mitte zuletzt eher als Holzweg erschien?!
Dann, endlich: Der erwartete Auftritt. Heidimania, in der Nachbarstadt erwägen sie schon die Umbenennung in Reichinnekkirchen. Ratskandidat Batıkağan Pulat, der mit Heidi (sie möchte geduzt werden und nach 30 Jahren Klum ist es ja wirklich an der Zeit, sich den Kinderbuchklassikernamen mal zurückzuholen) auf die Bühne kommt, ruft entzückt: „Ihr seid so sweet, hier ist so viel Liebe. Mega!“, und ich — nun, ich bin 41 Jahre alt und hier nur bedingt die Zielgruppe.

Auch Heidi ist natürlich „geflasht“ und komplimentiert das Publikum in jetzt wirklich perfekter Popstar-Aneignung: „Sowohl die Sonne als auch Ihr blendet!“ Vor ihr auf dem Platz zwinkert ein Plakat der Linken für die Kommunalwahl der Gen‑Z freundschaftlich zu: „Geht Wählen, ihr Mäuse“. Ich bin ein bisschen verunsichert (und habe eh eine irrationale Angst, dass Susanne Daubner an jedem noch so abgelegenen Ort plötzlich auftauchen und „Cringe, Digger!“ sagen könnte), möchte mich aber vehement nicht wie Thomas Gottschalk fühlen und wähne mich daher mitgemeint.
Sie freue sich, hier zu sein, erklärt Heidi, würzt diese Politiker*innen-Klischee-Äußerung aber mit einem Rundumschlag gegen den Nahverkehr in NRW, diese Acht-Bit-Simulation existierender Infrastruktur, der auch wechselnde Verkehrsminister und lässige Social-Media-Strategien der ca. 200 verschiedenen Nahverkehrsanbieter nichts von ihrer abscheulichen Unterdurchschnittlichkeit nehmen können. Bei ihr ist es nur ein Halbsatz, aber es ist ein sehr emotionales Thema, bei dem sie mich sofort hat.
Schnell singt sie noch das Loblied des Ruhrgebiets; Malochertum, Strukturwandel. Es erinnere sie hier an ihre Heimat im Osten, sagt sie, weil es da ähnlich aussähe, und das durchaus wohlwollende Publikum ist jetzt für einen Moment wirklich verunsichert, ob das irgendwie als Kompliment durchgehen kann und wenn ja, als ein toxisches.
Es würde absolut niemand erwarten und auch gar nicht passen, aber: Heidi Reichinnek hält hier keine Bierzeltrede. Per Social Media hatte man im Vorfeld Fragen mit den Schwerpunkten Bochum und Junge Leute einreichen können, von denen Batıkağan jetzt eine Auswahl vorliest. Das ist natürlich doppelt clever, bringt es doch Nähe und geht gleichzeitig auf Nummer Sicher, denn niemand ist so doof, im Jahr 2025 noch ein Mikrofon ins Publikum zu halten — noch dazu bei einer Klientel, wo die Stimmung zwischen zwingend notwendiger Kritik an der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu und stumpfem Antisemitismus, der aber natürlich „antikolonial“ und „aufklärerisch“ gelesen werden möchte, schwankt. Vor mir steht ein ca. 15-jähriges Mädchen in einem T‑Shirt, dessen schlichte Symbolik eigentlich nur so verstanden werden kann, dass sie die Abschaffung Israels zugunsten eines Palästinenserstaats fordert. So unschön wie alltäglich dieser Tage.
Es soll also bitte nicht um geopolitische Großthemen gehen, die lösen zu können wollen schon die unendliche Schlichtheit eines Donald Trump erfordert. Stattdessen: Wie kann man Jugendliche davon abhalten, rechtsradikal zu werden? Keine ganz schlechte Frage an eine studierte Politikwissenschaftlerin, die lange in der Jugendhilfe gearbeitet hat.
Die Antwort, nicht wirklich überraschend, aber eben auch naheliegend und nachvollziehbar: Breite Angebote für Jugendliche, direkt vor der Haustür. Schulsozialarbeit, die jungen Menschen das Gefühl gibt, gesehen zu werden, bevor es rechtsradikale Grillabende und Social-Media-Accounts tun. Soziale Infrastruktur als Absicherung gegen den Rechtsruck. Also das, was marktradikalisierte Durchoptimierungsfetischisten am Liebsten immer als Erstes kürzen.
Und dann, ein Hauch wohldosiertes Barack-Obama-Gedächtnispathos, das aber auch die ganz simple Wahrheit ist: „Wenn Ihr Euch umguckt, verbindet Euch mit den Menschen um Euch viel mehr, als Euch trennen könnte.“ Natürlich greift Heidi den politischen Gegner immer mal wieder an, aber Christian Lindner und Friedrich Merz bleiben die einzigen Vertreter, die sie namentlich nennt. Die AfD erwähnt sie als solche nur einmal; recht spät, als sie über deren Social-Media-Strategie spricht, die ja leider ziemlich erfolgreich sei. Anders als gewisse bayrische Ministerpräsidenten, die erst glücklich scheinen, wenn sie anderen Parteien minutenlang Unfähigkeit unterstellt haben wie ein Trinker in der Eckkneipe, der sich immer über seine „Alte“ aufregt, versucht sie es lieber mit konstruktivem Optimismus, der sich um etwas mehr bemüht, als „Zuversicht“ zu sagen. Gleichzeitig betont sie, dass Fortschritt immer Zeit brauche: „Wir versprechen Euch nicht das Blaue vom Himmel“. Na gut, Willy Brandt hatte es, hier im Ruhrgebiet, auch am Himmel versprochen. Und gehalten.
Die Frage, ob sie wegen ihrer hohen Sprechgeschwindigkeit mal über eine Rap-Karriere nachgedacht habe, verneint sie: kein Flow. Rhetorisch wäre sie den allermeisten Deutschrappern weit überlegen und man ahnt, dass sie das weiß. Leuten, die mit 1.500 Euro netto in TikTok-Kommentaren Milliardäre verteidigen, ruft sie zu: „Du musst die Stiefel, mit denen Du getreten wirst, nicht auch noch lecken!“, um dann, weltoffen und humoristisch durchaus gelungen, hinzuzufügen: „Nicht falsch verstehen: No Kink-Shaming!“ Und es scheint zu exakt gleichen Teilen plausibel, dass sie diesen Gag schon mehrfach gebracht hat, oder er gerade einfach so aus ihr herausgesprudelt kam.
Man kann sich vorstellen, warum diese Frau Menschen triggert, die ungelenk vor iPads sitzen und versuchen, locker oder auch nur menschlich zu wirken, während sie in eine Handykamera Social-Media-Fragen von jungen Menschen beantworten — und zwar möglichst ohne „Tagesschau“-taugliche Worthülsen, also quasi nackt.
Es erscheint überflüssig, das bei einer Millennial, die Social Media so gut beherrscht, noch einmal zu betonen, aber Heidi ist natürlich auch selbstironisch: „Wenn wir was können als Linke, dann ist es Papiere schreiben“, sagt sie und bezeichnet sich selbst als „Kommunalnerd“. Sichtlich begeistert steigert sich in die Details hinein, wie man die dauernden Mietpreissteigerungen beenden könnte, und bricht doch das Meiste sehr gut runter und formuliert zielgruppenoptimiert — also jung und akademisch angehaucht.
Wenn sie mal eine Vokabel aus dem Fremdwörterlexikon holt, wird die so anmoderiert, dass die alleinerziehende Kassiererin aus Hofstede dabei noch was lernen kann. Wie das Wort „Femizid“: „Das ist kein ‚Beziehungsdrama‘ oder eine ‚Familientragödie‘, sondern das ist ein verfickter Mord.“ Und irgendwo fällt wieder einem Boomer das Monokel runter.
Nach einer halben Stunde ist das Q&A beendet, es soll noch genug Zeit für Fotos und Autogramme bleiben: „Stellt Euch bitte in einer Reihe auf!“ Ich habe mir im Alter von elf Jahren mal die Unterschrift von Heiner Geißler auf dem Neutorplatz in Dinslaken geholt, weil ich den aus der Zeitung kannte, und verwahre das Autogramm von Willy Brandt, das mir ein Kollege meines Vaters mal überlassen hat, wie einen Schatz (in dem Sinne, dass ich es erstmal suchen müsste), aber das hier heute ist nicht meine Party.
Man kann es seltsam finden, dass Heidi derart abgefeiert wird („Wie ein Popstar“, kommt, schreibt es, „WAZ“!), aber wenn man kein mittelalter, weißer Mann ist, mit Hemd, Krawatte und Anzug verwachsen, findet man in der Politik immer noch auffallend wenige Menschen, die so aussehen wie man selbst. Solange in der Union (und durchaus auch an anderen Stellen) niemand merkt, wie wenig repräsentativ die immergleichen Gruppenfotos voll geklonter stellvertretender Sparkassenfilialleiter sind; solange Philipp Amthor so etwas wie frischen Wind verkörpern soll; solange die SPD, Regierungspartei in 23 der vergangenen 27 Jahre, sich wie ein ideenloser nasser Sack durch jede Manege und jeden Ring schleifen lässt; so lange werden es diese Parteien schwer haben, auch nur annähernd so einen Hype zu erzeugen wie Heidi Reichinnek es gerade für die Linke tut.
Sie schließt mit „Auf die Barrikaden!“, dann läuft wieder Taylor Swift.