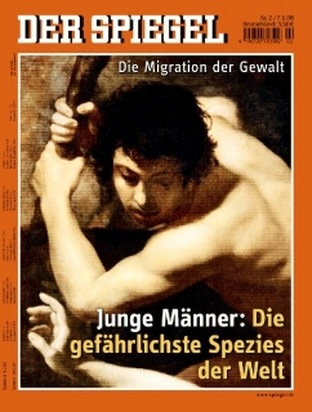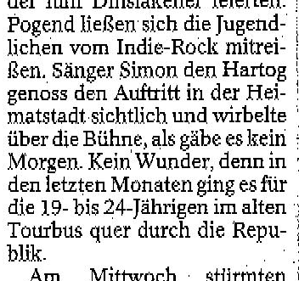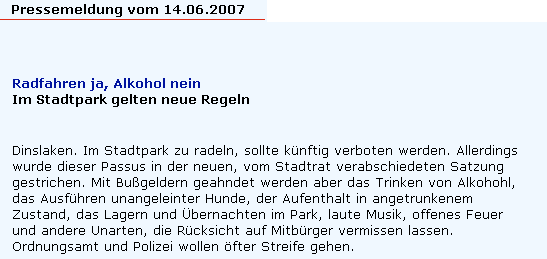Eigentlich sitze ich gerade an einem Text, in dem ich mal besonders gelungenen Journalismus vorstellen möchte. Dann allerdings bekam ich den Link zu einem YouTube-Video geschickt, das eine solch erschütternde Journalismusattrappe zeigt, dass ich (nachdem ich eine Viertelstunde zu den Klängen von Thursday mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen habe) mich erst einmal darüber auskotzen muss.
Das Video zeigt einen Beitrag aus der gestrigen Ausgabe von „Explosiv – Das Magazin“ auf RTL, hat also genau genommen gar nichts mit Journalismus am Hut. Allerdings haben 1,79 Millionen Menschen diese Sendung gesehen und die Vorstellung, dass auch nur einer diese Infotainment-Parodie ernst genommen haben könnte, macht mir Angst.
Es ging um Emos und weil viele Zuschauer vielleicht nicht wissen was das ist (Chance zum schlechten Witz mit australischen Laufvögeln verpasst), erklärt die Moderatorinnendarstellerin das Ganze noch mal kurz:
„Emo“ kommt von „emotional“ und Teenager, die dieser Bewegung anhängen, kleiden sich merkwürdig.
Außerdem neigten die Jugendlichen zu Depressionen, ritzten sich teilweise die Haut auf und überhaupt habe der Reporter einen Fall gefunden, „wo ein junger Mann sich umgebracht haben soll“.
Dann geht’s los mit blutigen Bildern, entsetzten Eltern und jovialen depressiven Jugendlichen.
Von dem jungen Mann, der „sich umgebracht haben soll“ (also er ist tot, nur ob das mit Emo zusammenhängt, ist nicht klar: er „war wahrscheinlich ein Emo“), wird ein (natürlich unverpixeltes) Bild gezeigt, das er vor seinem Tod „in ein Emo-Forum ins Internet gestellt“ hat. Wir müssen also ganz am Rande auch noch annehmen, dass RTL mal wieder Witwenschütteln 2.0 betrieben hat.
Das Bild zeigt – und jetzt kommt’s – einen grimmig dreinschauenden jungen Mann mit Palästinensertuch vor einem Poster, das wenn ich mich nicht sehr irre, die Metalband Metallica zeigt. D’oh! Weniger Emo geht nun wirklich kaum.
Er trägt das typische Emo-Tuch, ‚Pali‘ genannt.

Journalisten hätten sich vielleicht die Mühe gemacht, den Ursprung der Emo-Bewegung zu erklären. Man hätte sehr weit ausholen und bis zu Embrace (US), Rites Of Spring, Fugazi und The Promise Ring gehen können, wenn man sich mit der ursprünglichen Emo-Szene unter musikalischen Aspekten hätte beschäftigen wollen, man hätte aber wenigstens über Unsicherheit, Einfühlungsvermögen und Hoffnungslosigkeit sprechen können. Im Feuilleton hätte man Parallelen zum Sturm und Drang, der Jugendbewegung der 1770er Jahre, geschlagen, in jedem Fall hätte man aber sagen müssen, dass der Begriff „Emo“ in etwa so schwammig sei wie der des „Jugendlichen“ und dass man sich im folgenden auf einen kleinen Kreis beschränken und holzschnittartige Verallgemeinerungen auffahren müsse. Dafür aber war in einem Sechsminüter kein Platz.
Das Wort „Emo“ war also im folgenden ein Platzhalter für „merkwürdig gekleidete Jugendliche, die sich alle immer die Arme aufschneiden, was wir aus dem Internet wissen, die das aber vor unserer Kamera nicht zugeben wollen“.
RTL machte aber nicht nur so grobe inhaltliche Fehler, der Beitrag war bis ins kleinste handwerkliche Detail schlecht. Immer wieder wurden in Großaufnahme die gleichen sensationslüsternen Bilder von aufgeschnittenen Gliedmaßen gezeigt, die wer-weiß-woher stammten. Ja, sie haben es noch nicht einmal geschafft, Texteinblendungen und Off-Sprecher auf eine Linie zu kriegen: zu den aus dem Kontext irgendeines „Emo-Forums“ gerissenen (und offenbar in MS Paint gesetzten) Worten „es ist allen SCHEIß EGAL!!!!“ sagt die um Bedeutungsschwere und Dramatik bemühte RTL-Standardstimme, es sei „alles“ scheißegal.
Der aufgetane Psychologie Dr. Christian Lüdke wirft Emos und Satanisten munter in einen Topf, spricht von der „Faszination des Abscheulichen“ und sagt, Emos wollten „provozieren“. Als nächstes erklärt der Sprecher, „sie“ (es geht also in jedem Moment um ausnahmslos alle Emos) seien „beziehungsgestört, aber sie demonstrieren Nähe“. Ähnlich informativ wäre es zu behaupten, Menschen seien allesamt weiblich, hätten blaue Augen und ein Bein: alles trifft ja sicher in einigen bis etlichen Fällen zu, wer würde sich da noch mit Rasierklingenspalterei aufhalten wollen?
Sie sind lieb zueinander und geben sich harmlos vor der Kamera – doch im Internet zeigen sie ihre wahren Abgründe: ich lebe, doch eigentlich bin ich schon tot.
Eine Mutter ist der Meinung, dass es andere Dinge gäbe, die Jugendliche machen könnten, als zusammen zu ritzen, zu saufen und zu kiffen. Ich muss zugeben, das Bild, das in diesem Moment in meinem Kopf entstand, hatte was: zwanzig misanthropische Straight-Edger sitzen zusammen in einem elterlichen Wohnzimmer, trinken Hansa-Pils, rauchen Gras und sägen – alle zusammen und jeder für sich – an ihren Unterarmen rum.
Es gibt vielfältige Beweise dafür, dass Emos zur Selbstverstümmelung neigen.
Diese „Beweise“ sind irgendwelche Bilder mit morbider Szenerie: von der Decke baumelnde Körper, verwahrloste Mädchen, die Herzen auf eine Wand malen, Rasierklingen in der Unterlippe. Oder mit anderen Worten: alles, was die Google-Bildersuche nach dem Begriff „Emo“ so hergab.
Eine zugegebenermaßen gelungene Szene ist der Dialog zwischen drei Emo-Mädchen und einem Styler, bei dem die Ach-so-Einfühlsamen plötzlich gar nicht mehr so genau erklären können, was sie eigentlich sind und sich händchenhaltend in eine hilflose Diskussion stürzen, die sie anschließend als „typisch“ bezeichnen.
Hier wäre die Gelegenheit gewesen, das, was heute „Emo“ genannt wird, als die Pose zu entlarven, die sie oft genug nur noch ist. Als Bricolage aus Punk, Gothic, Visual Kei, Rockabilly und Hello Kitty. Stattdessen wird die anti-aufklärerische Panikmache noch auf die Spitze getrieben.
Emos: offenbar eine typische Erscheinung der Pubertät. Leichtfertig wird hier mit der Selbstverstümmelung kokettiert. Und es gibt viele Jugendliche, die das toll finden, die ziemlich naiv in diese Sackgasse tappen.
„Naiv“ und „Sackgasse“ sind freilich Begriffe, die für diesen unfassbaren Beitrag noch wohlwollend wären.
Liebe Eltern, die Sie jetzt denken „Hilfe, mein Kind ist Emo! Wie krieg ich die Beerdigung bezahlt?“: bitte glauben Sie nicht diesen enthirnten Schwachsinn, den RTL gestern Abend in Ihre Kacheltisch-Wohnzimmer gesendet hat. Wenn Sie ungefähr verstehen wollen, was Emo ist, Sie also Ihr Kind verstehen wollen, greifen Sie bitte zu „Everybody Hurts“ von Leslie Simon und Trevor Kelley. Dafür müssen Sie etwas Englisch können, aber hinterher wissen Sie wenigstens, worum es geht.