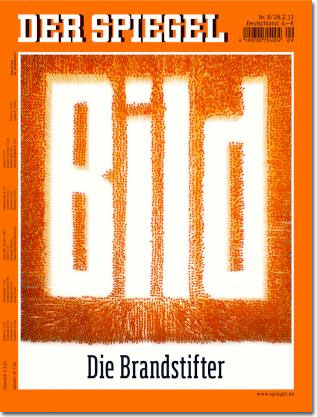Neulich war ich auf einer Journalistentagung. Ich konnte das vor mir selbst rechtfertigen, indem ich auf dem Podium sagte, dass ich keine Journalistentagungen (und keine Bloggertreffen) mag. Die anwesenden Journalisten waren anschließend so nett, mir noch einmal zu erklären, warum das eigentlich so ist.
Ich saß im Publikum einer Diskussion über das Urheberrecht, die ganz außergewöhnlich kuschelig zu werden drohte, weil niemand, der vorher irgendwelche Aufrufe zur Rettung des Urheberrechts (vor wem auch immer) unterzeichnet hatte, an der Diskussion teilnehmen wollte. (Oder konnte — vielleicht fand zeitgleich das Jahrestreffen der Offene-Briefe-zur-Rettung-des-Urhebberrechts-Unterzeichner statt, wer weiß schon, was Menschen, die offene Briefe unterzeichnen, so in ihrer Freizeit machen.)
JEDENFALLS: Ein Vertreter der Piratenpartei erklärte gerade, dass es ja durchaus viele Menschen gebe, die für Inhalte zahlen würden, diese Bezahlung in vielen Fällen aber unmöglich sei. Die populäre Fernsehserie “Game Of Thrones” etwa werde vom Sender HBO ausschließlich über ihren Bezahlkabelkanal vertrieben und ein Jahr nach Ausstrahlung der Staffel auf DVD veröffentlicht. Wer die Serie zeitnah sehen wolle (etwa, um im Freundeskreis mitreden zu können), werde quasi in die Illegalität gezwungen, selbst wenn er eigentlich bereit wäre, gutes Geld für einen legalen Zugang zu zahlen.
Tatsächlich ist diese HBO/”Game of Thrones”-Geschichte ein bemerkenswerter Fall, denn eine neue Zugangsmöglichkeit zu den HBO-Serien würde das eigentliche Geschäftsmodell des Senders, den Absatz seiner Kabelpakete, gefährden. Statt dieses Risiko einzugehen, nimmt HBO die weltweite Verbreitung der Serie durch Dritte einigermaßen billigend in Kauf — und hofft offenbar darauf, dass die Fans dann schon noch anschließend die DVDs kaufen werden.
Über all das wurde bei der Podiumsdiskussion nicht gesprochen, denn es erhob sich ein Mann (wie ich annehmen muss: ein Journalist) im Publikum und fing lautstark zu schimpfen an: Wo wir denn da hinkämen, wenn der Konsument plötzlich bestimmen würde, auf welchem Weg und zu welchen Konditionen er das Produkt geliefert bekomme?! Wenn der Sender die Serie nicht anders verkaufen wolle, müsse man halt warten. Man würde ja auch nicht beim Bäcker sagen: “Du willst zwanzig Cent für die Brötchen, aber ich geb’ Dir nur zehn!” (Ich kann mich nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber die Brötchenpreise waren definitiv nicht zeitgemäß.)
Mal davon ab, dass seine Wortmeldung vergleichsweise weit am eigentlichen Punkt vorbeiging und ich ob seines Geschreis ganz dringend aus dem Veranstaltungsraum fliehen musste, blieb mir der Mann im Gedächtnis.
Was, so dachte ich, muss bei einem Autor falsch gelaufen sein, damit er seine Texte mit Brötchen vergleicht?
Gestern dann verfolgte ich im Internet eine weitere Podiumsdiskussion und wieder fing irgendein Chefredakteur an, von Brötchen zu reden. Da dämmerte mir: So wird das nichts mehr mit dem Journalismus in Deutschland.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das Backhandwerk ist ein ehrenwertes Gewerbe, vor dem ich – wie vor allen Handwerken – größten Respekt haben. Wer möchte schon mitten in der Nacht aufstehen, um Mehlstaub einzuatmen und seine Hände in eine klebrige Masse zu drücken? Darüber hinaus ist es eine hohe Kunst: Es ist außerhalb Deutschlands nahezu unmöglich, ein gescheites Brot zu finden, und wirklich gute Brötchen findet man nirgendwo mehr, seit die Bäckerei Hallen in Dinslaken ihre Pforten hat schließen müssen.
Damit wir uns des weiteren nicht falsch verstehen: Auch ich möchte für meine Arbeit, in diesem Fall das Erstellen von Texten und lustigen Videos, angemessen entlohnt werden.
ABER: Meine Texte sind keine Brötchen! Niemandes Texte sind das!

Zwar scheinen manche Journalisten und die meisten Verleger überzeugt, dass ihre Texte für die Menschheit so wichtig sind wie das tägliche Brot, aber das macht sie noch nicht zur Backware.
Man könnte das natürlich durchspielen und augenzwinkernd feststellen, dass die Leute anscheinend auf Marie-Antoinette gehört haben und jetzt einfach Kuchen essen statt Brot. Dafür müsste man sich noch überlegen, was in dieser Metapher jetzt der Kuchen wäre (Blogs? Google?), aber das Bild würde mit jedem Gedanken schiefer. Texte sind keine Brötchen!
Texte werden nicht gebacken, man kann sie nicht nach fünf Tagen kleinhobeln und mit ihnen Schnitzel panieren und vor allem werden Texte nicht an Leser verkauft, sondern an Verleger. (Dass die dann sagen, sie würden gerne aber nur die Hälfte des Preises zahlen wollen, ist das eigentliche Problem für die Journalisten.)
Das ganze Themenfeld “geistiges Eigentum” ist vermint mit hinkenden Vergleichen, aus dem Boden von Fässern herausgeschlagenen Kronen, verunfallten Metaphern, falschen oder wenigstens überholten Annahmen und unglücklichen Begriffen. Ja, “geistiges Eigentum” ist schon ein solcher unglücklicher Begriff, weil der Geist ja eben so erfrischend unkörperlich ist. Das überfordert viele Vorstellungskräfte, weswegen die Katholische Kirche den Heiligen Geist kurzerhand in eine Taube gepackt hat. Das ist auch nur ein Bild, liebe Journalisten (wenn auch weit weniger bescheuert als gebackene Texte): Wenn Euch eine Taube auf den Kopf kackt, ist das in den seltensten Fällen ein Zeichen Gottes.
Wir können über alles diskutieren (ach, das tut Ihr ja schon seit 15 Jahren): über die Möglichkeit, einzelne Texte zu bezahlen; darüber, dass die Werbekunden ins Internet abwandern; über die schlechten Arbeitsbedingungen von Journalisten und die teils ekligen Verträge, die ihnen die Verlage vorlegen; darüber, dass guter Journalismus natürlich bezahlt werden muss, und über vieles mehr.
Aber wenn Menschen, die ausschließlich von der Kraft ihrer Gedanken leben, Texte mit Brötchen vergleichen, dann sehe ich für alle weiteren Gesprächsansätze ausgesprochen schwarz.