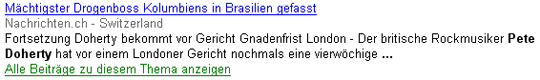Wenn die eigene Karriere im Pop-Business so richtig brach liegt, bleiben Frauen nur noch Nacktfotos und Männern Enthüllungsbücher. Auf letzteren stehen dann griffige Ankündigungen wie “Die Wahrheit über DSDS, Popstars & Co.” oder “Zwei Gewinner packen aus!”
Markus Grimm und Martin Kesici (dem Sie einen großen Gefallen täten, wenn Sie seinen Nachnamen auf der zweiten Silbe betonen) wissen, wie es wirken muss, wenn sie jetzt Jahre nach ihren Siegen bei “Popstars” (Grimm war 2004 in der extrem kurzlebigen, nur mittelerfolgreichen Kirmesgothickapelle Nu Pagadi) und “Star Search” (Kesici gewann 2003 in der Kategorie “Adult Singer”) mit einem Buch ankommen, auf dem “Die Wahrheit über DSDS, Popstars & Co.” und “Zwei Gewinner packen aus!” steht. Und tatsächlich finden die beiden ja plötzlich wieder in Medien statt, die jahrelang keine Notiz von ihnen genommen haben.
Aber Grimm und Kesici haben nichts mehr zu verlieren. Gemessen daran ist ihr Buch mit dem aufmerksamkeitsheischenden Titel “Sex, Drugs & Castingshows” ziemlich moderat ausgefallen: Es gibt kaum Namensnennungen (an einigen Stellen wie etwa bei einem Schlagersänger, der von sich selbst nur in der dritten Person redet, verwenden die Autoren statt Namen Piktogramme, was sich jetzt allerdings viel spektakulärer anhört, als es sich im Kontext dann tatsächlich liest), kaum schmutzige Wäsche und die titelgebenden Sex- und Drogenanekdoten kann man auch in jedem Interview zum Buch nachlesen.
“Das Popmusikbusiness ist schlecht und die Leute, die damit zu tun haben, sind noch mal einen Grad schlechter”, schreibt Grimm an einer Stelle (nur um eine halbe Seite später zu erklären, dass Schlager und volkstümliche Musik aber noch mal viel, viel schlimmer seien), aber das Buch widmet sich dann doch eher dem Business als den Leuten. Dass die Wahrheit bei Castingshows ein flexibles Gut ist, dürfte noch kaum jemanden überraschen. Etwas irritierender ist da schon das beschriebene Gebaren von Plattenfirmen, gerade etablierte Acts einfach abzusägen, weil das Nachfolgeprodukt schon in den Startlöchern steht. Der Laie würde ja womöglich sagen, dass zwei Pferde im Rennen die Gewinnchancen erhöhen. Aber deswegen führen wir ja alle keine Plattenfirmen.
Etwas länglich und umständlich zeichnen die Autoren ihren Weg in die Finalshows ihrer jeweiligen Sendereihen nach. Auch dem dämlichsten Leser – und, seien wir ehrlich: ein Buch über Castingshows läuft Gefahr, ein paar dämliche Leser zu finden – soll klar werden, dass er es hier mit zwei bodenständigen, ehrlichen Musikern zu tun hat, die eher zufällig zu Medienstars wurden. Und deren Namen heute noch so verbrannt sind, dass kaum jemand mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Kesici schnoddert sich durch seine Passagen und vermittelt den Eindruck, als gehe er inzwischen ganz souverän mit seiner Geschichte um. Bei Grimm hingegen hat man mitunter das Gefühl, dass ein paar klärende Gespräche mit einem Therapeuten vielleicht die bessere Idee gewesen wären, als sich den ganzen Frust von der Seele zu schreiben und das dann anschließend zu veröffentlichen.
Auch wenn die Geschichten über Manager und Plattenverträge natürlich alle Klischees bestätigen, die man als Außenstehender so vom Musikbusiness hatte (lassen Sie mich alle guten Ratschläge auf zwei Worte herunterbrechen: “NICHTS. UNTERSCHREIBEN.”), stellt man bei der Lektüre fest: Castingshows haben sehr viel mehr mit Fernsehen zu tun als mit Musik. In seinem Nachwort bemerkt Kesici sehr klug, dass Musiker “auf die Bühne, on the road” gehören, aber nicht ins Fernsehen. Dort geht es nämlich laut Autoren nur darum, Geschichten zu erzählen und das Publikum zu unterhalten und nicht darum, Künstler aufzubauen — womöglich noch langfristig.
Für das Erzählen von Geschichten gibt es ganze Verwertungsketten (RTL und ProSieben bestreiten damit quasi ihr gesamtes Programm), zu denen natürlich auch die Boulevardpresse gehört. So berichtet Kesici beispielsweise, wie sich ein “Bild”-Mitarbeiter (oder zumindest jemand, der sich als solcher ausgab) bei ihm meldete und mit der Ankündigung, wenn Kesici das Viertelfinale gewinne, werde man über seine Vorstrafe wegen Drogenbesitzes berichten, um ein Gespräch bat. Am Tag nach der Sendung machte “Bild” dann mit “Darf so einer Deutschlands neuer Superstar werden? Verurteilt wegen Drogen!” auf.
Auch eine weitere “Skandal”-Geschichte rund um “Star Search” fand in “Bild” ihren Anfang: Kesici beschreibt, wie er und zwei weitere Kandidaten wenige Tage vor dem großen Finale mit einer Limousine abgeholt wurden, in der Reporter von “Bild” und dem Sat.1-Boulevardmagazin “Blitz” warteten. Gemeinsam fuhr man in eine Tabledance-Bar, wo der “Bild”-Fotograf jene Fotos machte, die am darauf folgenden Tag den Artikel “Dürfen diese Sex-Ferkel neue Superstars werden?” bebildern sollten. Erstaunlich ist daran viel weniger, dass “Bild” involviert war, sondern, dass Sender und Produktionsfirma derartige Geschichten anscheinend auch noch forciert haben.
Sex- und Drogenparties in Promikreisen werden zwar erwähnt (Grimm schreibt seitenlang über – Achtung! – “eine After-Show, denn sie hatten alle keine Hosen an und zeigten ihren nackten Arsch und mehr”), aber zum großen Promiklatsch taugt das Buch nicht. Kesici behauptet, “dass 70 Prozent der Leute aus dieser Glitzer- und Glamourwelt bei solchen Partys auf Drogen sind”, enttäuscht aber zwei Sätze später die Erwartungen der enthüllungsgeilen Leserschaft mit dem Hinweis, dass er keine Namen nennen werde. Es ehrt ihn als Menschen, schadet aber natürlich der Vermarktbarkeit des Buchs.
So erfährt man stattdessen, wie es abläuft, wenn eine Plattenfirma ein Bandmitglied rausschmeißt oder einen Künstler droppt. Der Leser bekommt schnell den Eindruck, dass man besser einen Bandenkrieg unter südamerikanischen Drogenkartellen anzetteln sollte, als bei einer Major-Plattenfirma zu unterschreiben. Dafür gibt es im Anhang auch 50 Seiten (teilweise geschwärzte) Originalverträge, die man ohne mehrere juristische Staatsexamen natürlich kaum durchschaut. Wenn allerdings das, was ich nicht verstehe, genau soviel Quatsch enthält wie das, was ich verstehe, dann ist das ganz schön viel Quatsch.
“Sex, Drugs & Castingshows” ist letztlich Warnung vor den ganzen Verstrickungen, die die Teilnahme an so einem Casting mit sich bringt. Auch als Schilderung zweier Lebenswege, die von “Durchschnittstyp” zu “Superstar” und zurück führen, funktioniert das Buch einigermaßen gut. Es hätte allerdings geholfen, wenn das Manuskript zumindest mal kurzfristig in der Nähe von jemandem gelegen hätte, der sich mit dem Schreiben von Büchern auskennt.
Dass Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen verarscht werden, hatte man sich ja immer schon gedacht. Bei der Lektüre sieht man also vieles bestätigt, was man sowieso über die fehlende Wahrhaftigkeit solcher Sendungen geahnt hatte, gewürzt mir ein paar fassungslos machenden Anekdoten. Aber die versprochene Abrechnung, “die Wahrheit”, das alles fällt letztlich ein bisschen mager aus. Ja: Castingshows sind doof und gefährlich und jetzt wissen wir alle, warum. Das auf mehr als 350 Seiten ausgebreitet zu kriegen, ist vermutlich immer noch angenehmer, als die Verwertungsmaschinerie des Showgeschäfts selbst zu durchlaufen.
Markus Grimm/Martin Kesici – Sex, Drugs & Castingshows
Riva, 428 Seiten
17,90 Euro