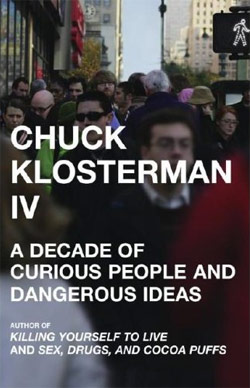 Manchmal neige ich zu sehr wohlwollenden Zukunftsprognosen. An diesem Eintrag war deshalb nahezu alles falsch: Das bestellte Buch kam nicht (wie wir inzwischen wissen) am darauffolgenden Montag an, sondern konnte erst nach einer Woche aus seiner Gefangenschaft befreit werden. Auch brauchte ich für die Lektüre nicht die veranschlagte eine Woche, sondern derer drei.
Manchmal neige ich zu sehr wohlwollenden Zukunftsprognosen. An diesem Eintrag war deshalb nahezu alles falsch: Das bestellte Buch kam nicht (wie wir inzwischen wissen) am darauffolgenden Montag an, sondern konnte erst nach einer Woche aus seiner Gefangenschaft befreit werden. Auch brauchte ich für die Lektüre nicht die veranschlagte eine Woche, sondern derer drei.
Jetzt aber: „Chuck Klosterman IV: A Decade of Curious People and Dangerous Ideas“ ist (wie der Titel schon nahelegt) das vierte Buch von Chuck Klosterman. Chuck Klosterman ist ein amerikanischer Musik‑, Film- und Popkulturjournalist, der lange Jahre für das „Spin Magazine“, aber auch für „Esquire“, das „New York Times Magazine“ und diverse andere Druckerzeugnisse gearbeitet hat. Ich kam mit seiner Arbeit erstmals bewusst in Kontakt, als der deutsche „Rolling Stone“ im vergangenen Jahr das Kapitel über Kurt Cobain aus dem damals frisch auf deutsch erschienenen Klosterman-Buch „Eine zu 85% wahre Geschichte abdruckte. Das Buch heißt im Original „Killing Yourself To Live“ („85% Of A True Story“ ist der Untertitel, sooo abwegig ist deutsche Variante dann doch nicht) und Klosterman reist darin durch die halben USA und klappert dabei Orte ab, an denen Rockstars zu Tode gekommen sind.
Als ich ein paar Monate später bei Borders in San Francisco stand und mich nicht entscheiden konnte, mit welchem Buch ich als nächstes meine Kreditkarte belasten sollte, fiel mir „Killing Yourself To Live“ in die Hände. Ich kaufte es, las es in einer Woche durch1 und wurde Fan. In den nächsten Wochen kaufte ich mir nacheinander „Sex, Drugs and Cocoa Puffs“, eine Artikel- und Essaysammlung über Popkultur im weiteren Sinne, und „Fargo Rock City“, ein Buch über Heavy Metal, Hardrock und Landleben, das sehr spät meine Begeisterung für die Musik von Guns N‘ Roses weckte.
„Chuck Klosterman IV“ war im letzten Herbst schon als Hardcover erschienen, aber ich wollte es zwecks besserer Optik im Bücherregal gerne ebenfalls als Taschenbuch haben.2 Dafür hab ich jetzt auch ein paar zusätzliche Essays und Fußnoten mit drin, die bei der Erstveröffentlichung teilweise noch gar nicht geschrieben waren. Essays und Fußnoten gibt es in dem Buch eine ganze Menge, denn es vereint – wie der Untertitel schon andeutet – Texte aus zehn Jahren und ist in drei Teile gegliedert: „Things that are true“, „Things that might be true“ und „Something that isn’t true at all“.
„Things that are true“ sind Porträts über Musiker wie Britney Spears, U2, Radiohead, Wilco oder Billy Joel, aber auch Reportagen über The-Smiths-Fantreffen voller Latinos, Goths in Disneyland und eine einwöchige Chicken-McNuggets-Diät (acht Jahre vor „Super Size Me“). Klosterman hat ihnen kleine Einführungen vorangestellt, die mitunter mindestens so unterhaltsam und erhellend sind wie die Artikel selbst. Er bemüht sich, seine Themen und Porträtierten ernst zu nehmen (sogar Britney Spears) und beschreibt Szenen, Gespräche und Ereignisse mit einem unglaublichen Gespür für Sprache und Komik. Dabei kommt es ihm sehr zu Gute, dass angelsächsischer Journalismus (im Gegensatz zum deutschen) dem Verfasser eine eigene Position und sogar ein Ich zugesteht. Statt umständlicher Konstruktionen kann er somit ganz persönliche Eindrücke bringen, die viel aussagekräftiger sind als es die Vortäuschung von Objektivität je wäre. Fast nie erhebt er sich über den Gegenstand, nur Europäer und Soccer sind Themen, bei denen er schnell emotional wird.
„Things that might be true“ vereint zahlreiche „Esquire“-Kolumnen zu eher abstrakten Gedanken. Er jongliert mit kulturtheoretischen, zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Themen, was ihm meistens sehr gut gelingt, worin er sich mitunter aber auch ein wenig verheddert. Diese Texte regen aber, mehr als die aus Teil Eins, zum Nachdenken an und ich bin mir sicher, dass sie an amerikanischen Unis bereits Gegenstand einiger Seminare und Hausarbeiten sind. Ihnen vorangestellt ist je eine (mitunter höchst hypothetische Frage), die den Leser schon mal an den Rand des Wahnsinns bringen kann. Beispiel gefällig?
Q: Think of someone who is your friend (do not select your best friend, but make sure the person is someone you would classify as „considerably more than an acquaintance“).
This friend is going to be attacked by a grizzly bear.
Now, this person will survive this bear attack; that is guaranteed. There is a 100 percent chance that your friend will live. However, the extent of his injuries is unknown; he might receive nothing but a few superficial scratches, but he also might lose a lim (or multiple limbs). He might recover completely in twenty-four hours with nothing but a great story, or he might spend the rest of his life in a wheelchair.
Somehow, you have the ability to stop this attack from happening. You can magically save your friend from the bear. But his (or her) salvation will come at a peculiar price: if you choose to stop the bear, it will always rain. For the est of your life, wherever you go, it will be raining. Sometimes it will pour and sometimes it will drizzle – but it will never not be raining. But it won’t rain over the totality of the earth, nor will the hydrological cycle be disrupted; these storm clouds will be isolated, and they will focus entirely on your specific whereabouts. You will never see the sun again.
Do you stop the bear and accept a lifetime of rain?
Also bitte, wie brillant ist denn sowas?
„Things that aren’t true at all“ enthält eine etwa dreißigseitige Kurzgeschichte über einen jungen Filmkritiker, dem einige ziemlich abgefahrene3 Sachen passieren. Die Geschichte ist gut geschrieben, mit der Klosterman-üblichen Liebe zu ausgefallenen Details und sie ist nur etwa dreißig Seiten lang. Viel mehr positives lässt sich darüber nicht sagen, sie ist halt „ganz nett“, aber ihr Fehlen hätte für das Buch keinen großen Makel bedeutet.
Wenn Sie sich jetzt seit ungefähr dem zweiten Absatz fragen, ob Chuck Klosterman „sowas wie der amerikanische Benjamin von Stuckrad-Barre“ sei: Schwer zu sagen. Beide beherrschen ihr Handwerk sicherlich sehr gut, aber es gibt schon deutliche Unterschiede, die ganz profan bei der Sprache anfangen (ich liebe dieses Formelhafte der englischen Sprache, ihre idiomatischen Wendungen und die zahlreichen Möglichkeiten, sich vom Beschriebenen zu distanzieren) und bei der Einstellung der Autoren gegenüber ihren Inhalten aufhören.
„Chuck Klosterman IV“ ist für alle, die sich für Popkultur im weiteren Sinne (und für amerikanische Massenkultur) interessieren, die gerne gut geschriebene Porträts und Reportagen lesen und sich für etwas abseitige Gedankengänge erwärmen können. Und für kuriose Leute.
1 Es ist bedeutend dünner als das neue Buch (257 zu 416 Seiten).
2 Ironie der Geschichte: Die Bücher stehen gar nicht bei mir im Regal. Das ist nämlich voll. Sie liegen jetzt auf einer Reihe stehender Bücher und werden noch dazu von einer Borussia-Mönchengladbach-Flagge verdeckt.
3 Demnächst an dieser Stelle: Die zehn schönsten Achtziger-Jahre-Adjektive.

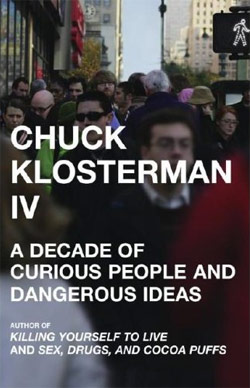 Manchmal neige ich zu sehr wohlwollenden Zukunftsprognosen. An
Manchmal neige ich zu sehr wohlwollenden Zukunftsprognosen. An